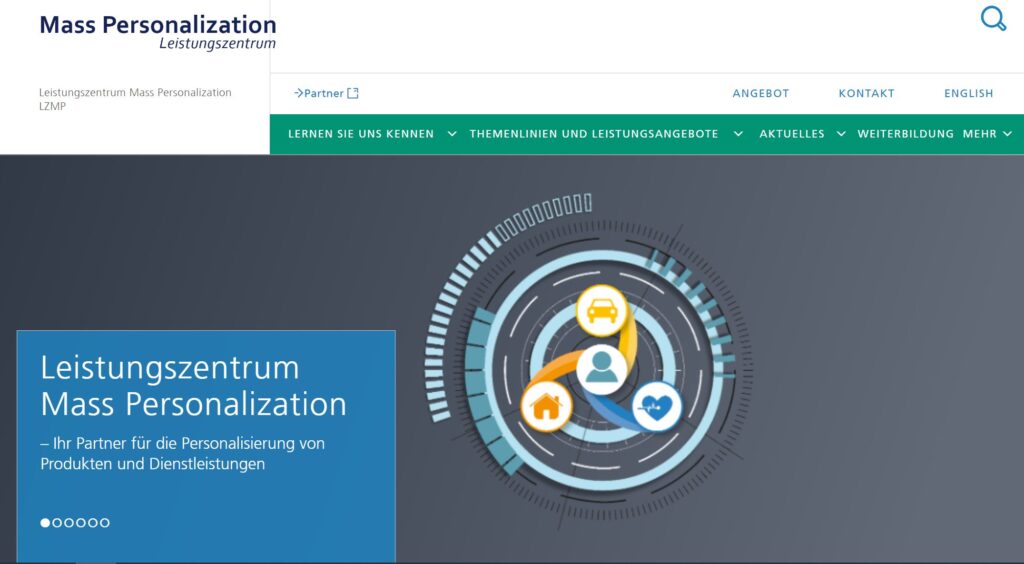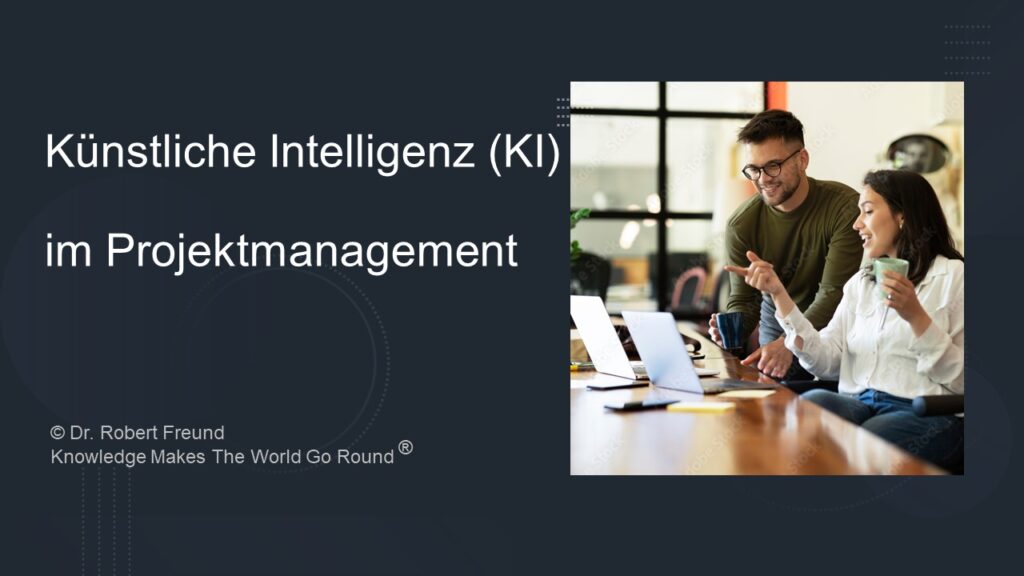
In vielen Blogbeiträgen haben wir erläutert, wie wichtig der Begriff „Kompetenz“ in einem turbulenten und komplexen Umfeld ist. Es ist für Organisationen daher wichtig, ihr Kompetenzmanagement auf den Ebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk zu entwickeln. Hinzu kommen heute und in Zukunft noch die Anforderungen zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz, die auch entsprechende Kompetenzen erfordern.
Je nachdem welche Historie ein Unternehmen hat, wird es daher entweder die KI-Dominanz oder auf der anderen Seite eher die menschliche Dominanz bei der Frage nach geeigneten Kompetenzen favorisieren. Wenn wir uns beide Extreme als Pole vorstellen wird klar, dass es dazwischen sehr viele Zwischenzustände gibt, bei denen technische (KI) und menschliche Kompetenzen zusammenwirken sollten. Eine solche Betrachtungsweise kann auch als Hybrides Kompetenzmanagement bezeichnet werden, das ein Kontinuum an Möglichkeiten bietet. Der folgende Text bezieht sich darauf, wie das im Rahmen von Künstlicher Intelligenz im Projektmanagement aussehen kann.
„Eine zentrale Herausforderung besteht darin, dass wir es mit einer Hybridisierung von Kompetenzen zu tun haben. Dieser Begriff bezieht sich auf die Verflechtung von technisch orientierten und menschlich orientierten Fähigkeiten. Im Kontext von KI bedeutet das, dass Mitarbeiter nicht nur technische Kenntnisse in Bereichen wie Datenanalyse oder KI-Programmierung haben müssen, sondern auch menschliche Kompetenzen, wie z. B. Kreativität, kritisches Denken oder zwischenmenschliche Fähigkeiten, um effektiv mit KI-Systemen zu interagieren und zu arbeiten. Darüber hinaus beinhaltet ein zukunftsweisendes Kompetenzmodell die Berücksichtigung von transversalen Kompetenzen. Transversale Kompetenzen sind solche, die über verschiedene Aufgabenbereiche und Themenfelder hinweg relevant sind. Sie sind nicht auf einen spezifischen Kontext beschränkt, sondern übertragen sich auf eine Vielzahl von Situationen und Herausforderungen. Dies könnte Kommunikation, Problemlösung oder strategisches Denken beinhalten“ (Reinhardt, K.; Feseker, M. 2024).
Die Autoren haben ein entsprechendes Kompetenzmodell entwickelt, auf das ich in den nächsten Blogbeiträgen eingehen werde. Man kann allerdings hier schon erkennen, dass sich diese Betrachtung von hybriden Kompetenzen im Projektmanagement von den üblichen Kompetenzrahen wie der Individual Competence Baseline (ICB 4.0) unterscheidet.

Solche Zusammenhänge thematisieren wir auch in den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen, die wir an verschiedenen Standorten anbieten. Weitere Informationen zu den Lehrgängen und zu Terminen finden Sie auf unserer Lernplattform.