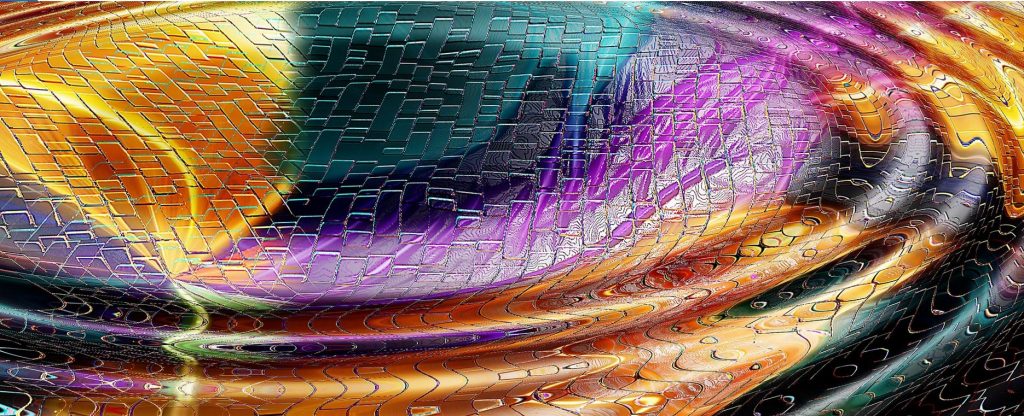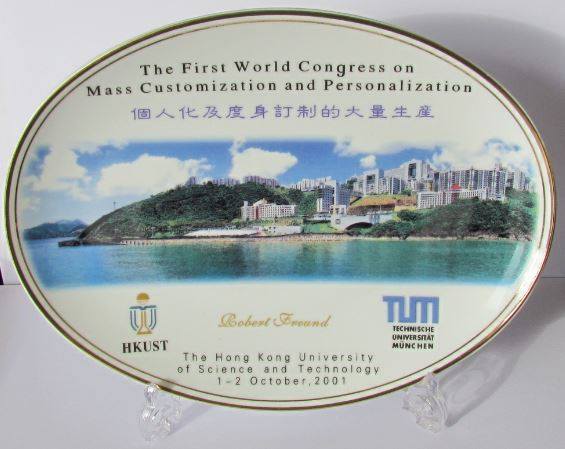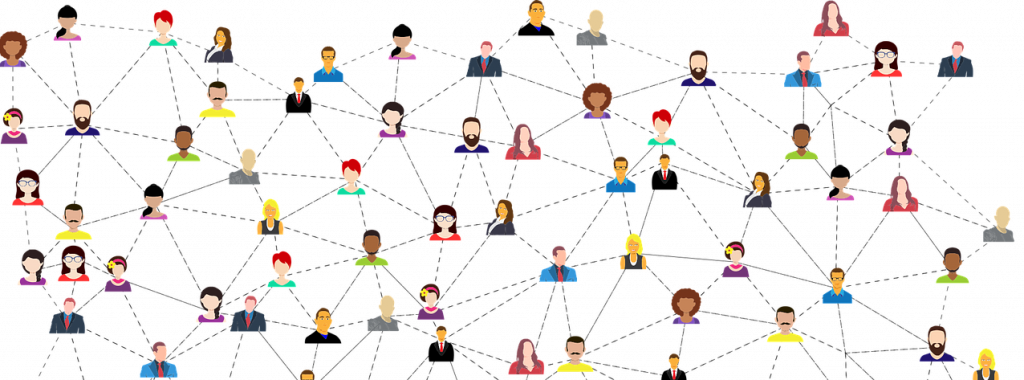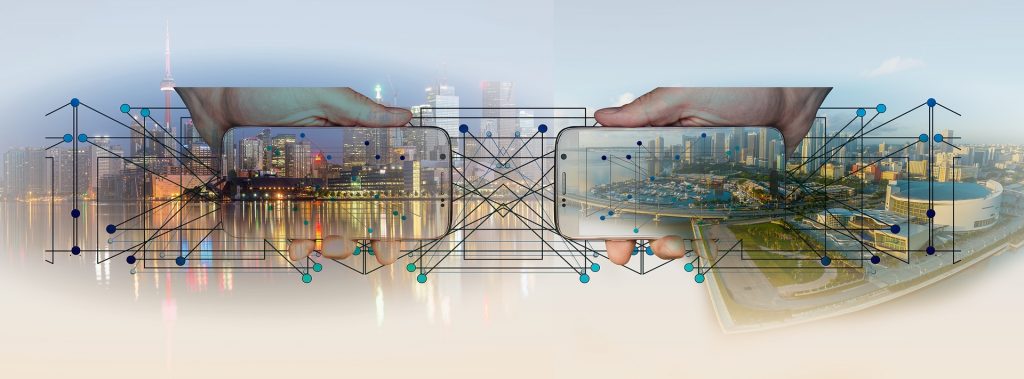
In unserem Blog habe ich schon des Öfteren darauf hingewiesen, dass es neben dem simple problem solving (SPS) auch das complex problem solving (CPS) gibt. In der heute immer stärker vernetzten Welt kommt somit in Zukunft dem CPS eine stärkere Bedeutung zu. Doch was sind Eigenschaften von komplexen Aufgabenstellungen? Die folgende Übersicht wurde zitiert in Marrenbach, Dirk; Korge, Axel (2020:36): Partizipative Transformation von Arbeitswelten: Die industrielle Revolution Schritt für Schritt meistern
Zukunftsprojekt Arbeitswelt 4.0 Baden-Württemberg. Bd. 15.. Fraunhofer IAO, Stuttgart. Dabei beziehen sich die Autoren auf Prilla, Michael; Frerichs, Alexandra; Rascher, Ingolf; Herrmann, Thomas: Partizipative Prozessgestaltung von AAL-Dienstleistungen: Erfahrungen aus dem Projekt service4home. In: Shire, Karen A.; Leimeister, Jan Marco: Technologiegestützte Dienstleistungsinnovation in der Gesundheitswirtschaft. Springer, Wiesbaden, 2010:
Komplexe Aufgabenstellungen stellen ‚wicked problems‘ dar. Verzwickte Probleme sind durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet:
– Es gibt keine klare Beschreibung des Problems.
– Es gibt keine richtigen oder falschen Ergebnisse, sondern nur mehr oder weniger angemessene Problemlösungen.
– Es gibt keine Methoden zur zuverlässigen Prognose der Qualität einer Lösung.
– Es gibt keine Angaben zur Anzahl möglicher Lösungen und Lösungsvarianten.
– Es gibt keine Angaben über die Menge der Methoden, die zur Lösung des Problems herangezogen werden können.
– Jedes „Wicked Problem“ ist einzigartig! Eine eins zu eins Übertragung der für ein ‚Wicked problem‘ gefundenen Lösung auf ein anderes ‚wicked problem‘ ist unmöglich.
– Es gibt keine Regel zur Definition von Abbruchkriterien für die Lösungsfindung.