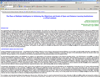 Der Beitrag von Ojo und Olakulain wurde veröffentlicht im Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE July 2006 ISSN 1302-6488 Volume: 7 Number: 3 Article: 1. Interessant ist dieser Artikel, weil er auf den Zusammenhang zwischen Open Distance Learning (ODL) und Multiple Intelligence eingeht (Darauf hatte ich grundsätzlich in meinem Vortrag auf der ELearnChina2003 hingewiesen). Die Autoren stellen darüber hinaus auch ein neues Modell zur Diskussion: „The model conceives effective team and group activities as a product of multiple intelligence. This view is completely opposed to the great-man conception of team/group direction in which superior intelligence is seen as being vested in a particular individual or cadre of individuals who are solely responsible for developing policy direction for the effectiveness of organizational functioning. Each of the organizational subsystems within the open and distance learning system can only succeed if the dynamic interplay between the various admixtures of skills present within the subsystem is effectively annexed to in the operations of the sub-system. This is the micro-application of the concept of multiple intelligence in the development of departmental goals and objectives as well as the means of achieving these group objectives.“
Der Beitrag von Ojo und Olakulain wurde veröffentlicht im Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE July 2006 ISSN 1302-6488 Volume: 7 Number: 3 Article: 1. Interessant ist dieser Artikel, weil er auf den Zusammenhang zwischen Open Distance Learning (ODL) und Multiple Intelligence eingeht (Darauf hatte ich grundsätzlich in meinem Vortrag auf der ELearnChina2003 hingewiesen). Die Autoren stellen darüber hinaus auch ein neues Modell zur Diskussion: „The model conceives effective team and group activities as a product of multiple intelligence. This view is completely opposed to the great-man conception of team/group direction in which superior intelligence is seen as being vested in a particular individual or cadre of individuals who are solely responsible for developing policy direction for the effectiveness of organizational functioning. Each of the organizational subsystems within the open and distance learning system can only succeed if the dynamic interplay between the various admixtures of skills present within the subsystem is effectively annexed to in the operations of the sub-system. This is the micro-application of the concept of multiple intelligence in the development of departmental goals and objectives as well as the means of achieving these group objectives.“
Aulinger, A. (2006): Kollektive Intelligenz – Zugänge zur Intelligenz der vielen Unverbundenen
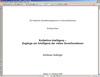 In dem Beitrag (Working Paper) von Prof. Dr. Aulinger wird vorgeschlagen, das Thema Kollektive Intelligenz differenzierter zu betrachten: „Dazu werden [nachfolgend] zwei Hauptströmungen kollektiver Intelligenz beschrieben, von denen jede wiederum zahlreiche Ausdifferenzierungen kennt. Dabei handelt es sich um (1) um die Intelligenz der vielen Unverbundenen und (2) um die Intelligenz der vielen Verbundenen.“ Weiterhin werden noch konkrete Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt.
In dem Beitrag (Working Paper) von Prof. Dr. Aulinger wird vorgeschlagen, das Thema Kollektive Intelligenz differenzierter zu betrachten: „Dazu werden [nachfolgend] zwei Hauptströmungen kollektiver Intelligenz beschrieben, von denen jede wiederum zahlreiche Ausdifferenzierungen kennt. Dabei handelt es sich um (1) um die Intelligenz der vielen Unverbundenen und (2) um die Intelligenz der vielen Verbundenen.“ Weiterhin werden noch konkrete Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt.
DIE ZEIT vom 30.11.2006: Macht Musik (Mit Hinweis auf die Multiple Intelligenzen Theorie)
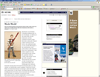 Dieser Beitrag (DIE ZEIT vom 30.11.2006) hat mich positiv überrascht, denn es wird hier ausdrücklich auf die Multiple Intelligenzen Theorie von Howard Gardner hingewiesen: „Der renommierte amerikanische Kognitionspsychologe Howard Gardner etwa hat eine Intelligenztheorie entwickelt, die auch emotionale und soziale Fähigkeiten einschließt. Er hält die musikalische Intelligenz für eine der wichtigsten Teilintelligenzen des Menschen.“ Wenn Sie mehr über die Multiple Intelligenzen Theorie erfahren wollen, so informieren Sie sich doch einfach auf der Website des von mir initiierten EU-Projekts MIapp, auf meiner Website oder in meinem MI-Blog. Je mehr über die Multiple Intelligenzen Theorie wissen, umso besser.
Dieser Beitrag (DIE ZEIT vom 30.11.2006) hat mich positiv überrascht, denn es wird hier ausdrücklich auf die Multiple Intelligenzen Theorie von Howard Gardner hingewiesen: „Der renommierte amerikanische Kognitionspsychologe Howard Gardner etwa hat eine Intelligenztheorie entwickelt, die auch emotionale und soziale Fähigkeiten einschließt. Er hält die musikalische Intelligenz für eine der wichtigsten Teilintelligenzen des Menschen.“ Wenn Sie mehr über die Multiple Intelligenzen Theorie erfahren wollen, so informieren Sie sich doch einfach auf der Website des von mir initiierten EU-Projekts MIapp, auf meiner Website oder in meinem MI-Blog. Je mehr über die Multiple Intelligenzen Theorie wissen, umso besser.
QUEM Report Teil 2 (2006): Metakompetenzen und Kompetenzentwicklung
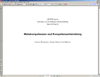 In dem QUEM-Report Teil 2 geht es den Autoren Bergmann/Daub/Meurer um „Metakompetenzen und Kompetenzentwicklung in systemisch-relationaler Sicht. Selbstorganisationsmodelle und die Wirklichkeit von Organisationen.“ Neben vielen interessanten Aspekten der Kompetenzdebatte gehen die Autoren auch der Frage nach, ob es eine Metakompetenz gibt. Die Frage ist deshalb so interessant, weil sie an die Intelligenzdebatte erinnert. In der Intelligenzdebatte geht es darum, ob es eine Intelligenz gibt oder möglicherweise mehrere, viele oder auch Multiple Intelligenzen. In dem QUEM-Report Teil 2 gehen die Autoren auch wirklich auf die Frage ein, und beziehen sich dabei ausdrücklich auf Gardner. Auf Seite 27 findet man folgenden Hinweis : „Zur Kategorisierung von Persönlichkeitsmerkmalen und damit auch Kompetenzen verweisen wir auf die Modelle des Brain Mapping und der Persönlichkeitsforschung (Bergmann 2001, S. 272 ff.; 2003 d; Roth 2001, S. 171 ff.; Gardner 1985, 1998).“ Das ist umso erstaunlicher, da die Multiple Intelligenzen Theorie von Gardner in Europa doch eher kritisch beurteilt wird (Siehe dazu auch das von mir initiierte EU-Prokekt MIapp). Im folgenden Text kommt es aber doch noch zu einer unterschiedlichen Interpretation auf Seite 113: „In Anlehnung an Howard Gardner lassen sich einige herausragende Persönlichkeiten der Geschichte als metakompetent beschreiben. Während Gardner Teilkompetenzen und spezifische Intelligenzbereiche mit Persönlichkeiten verknüpft, setzen wir bei metakompetenten Akteuren eine universelle Kompetenz voraus, die sich gerade nicht auf Spezialbereiche beschränken darf (Gardner 1991).“ Ich glaube, dass hier Gardner nicht richtig dargestellt wird. Nach Gardner können die verschiedenen Intelligenzen in einer Domäne aktiviert werden. Insofern setzt Gardner Intelligenzen nicht direkt mit Kompetenzen gleich. Auch Rauner (2004) zeigt auf, dass es zwar Überschneidungen bei den beiden Konstrukten gibt, aber Intelligenzen und Kompetenzen nicht gleichzusetzen sind. „Statt dessen sollten wir Intelligenz eher verstehen als die Fähigkeit, aus seinen Stärken ´Kapital zu schlagen´ und seine Schwächen zu kompensieren. Jeder Mensch verfügt über unterschiedliche Konfigurationen von Intelligenzen (Aissen-Crewett 1998:55-57)“. Es lohnt sich daher, die Intelligenz- und Kompetenzdebatte genauer zu beobachten.
In dem QUEM-Report Teil 2 geht es den Autoren Bergmann/Daub/Meurer um „Metakompetenzen und Kompetenzentwicklung in systemisch-relationaler Sicht. Selbstorganisationsmodelle und die Wirklichkeit von Organisationen.“ Neben vielen interessanten Aspekten der Kompetenzdebatte gehen die Autoren auch der Frage nach, ob es eine Metakompetenz gibt. Die Frage ist deshalb so interessant, weil sie an die Intelligenzdebatte erinnert. In der Intelligenzdebatte geht es darum, ob es eine Intelligenz gibt oder möglicherweise mehrere, viele oder auch Multiple Intelligenzen. In dem QUEM-Report Teil 2 gehen die Autoren auch wirklich auf die Frage ein, und beziehen sich dabei ausdrücklich auf Gardner. Auf Seite 27 findet man folgenden Hinweis : „Zur Kategorisierung von Persönlichkeitsmerkmalen und damit auch Kompetenzen verweisen wir auf die Modelle des Brain Mapping und der Persönlichkeitsforschung (Bergmann 2001, S. 272 ff.; 2003 d; Roth 2001, S. 171 ff.; Gardner 1985, 1998).“ Das ist umso erstaunlicher, da die Multiple Intelligenzen Theorie von Gardner in Europa doch eher kritisch beurteilt wird (Siehe dazu auch das von mir initiierte EU-Prokekt MIapp). Im folgenden Text kommt es aber doch noch zu einer unterschiedlichen Interpretation auf Seite 113: „In Anlehnung an Howard Gardner lassen sich einige herausragende Persönlichkeiten der Geschichte als metakompetent beschreiben. Während Gardner Teilkompetenzen und spezifische Intelligenzbereiche mit Persönlichkeiten verknüpft, setzen wir bei metakompetenten Akteuren eine universelle Kompetenz voraus, die sich gerade nicht auf Spezialbereiche beschränken darf (Gardner 1991).“ Ich glaube, dass hier Gardner nicht richtig dargestellt wird. Nach Gardner können die verschiedenen Intelligenzen in einer Domäne aktiviert werden. Insofern setzt Gardner Intelligenzen nicht direkt mit Kompetenzen gleich. Auch Rauner (2004) zeigt auf, dass es zwar Überschneidungen bei den beiden Konstrukten gibt, aber Intelligenzen und Kompetenzen nicht gleichzusetzen sind. „Statt dessen sollten wir Intelligenz eher verstehen als die Fähigkeit, aus seinen Stärken ´Kapital zu schlagen´ und seine Schwächen zu kompensieren. Jeder Mensch verfügt über unterschiedliche Konfigurationen von Intelligenzen (Aissen-Crewett 1998:55-57)“. Es lohnt sich daher, die Intelligenz- und Kompetenzdebatte genauer zu beobachten.
Hans Magnus Enzensberger: Im Irrgarten der Intelligenz. In: Neue Zürcher Zeitung vom 11. November 2006
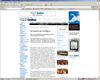 In dem Beitrag geht es um die Irrungen der Intelligenzmessung: „Alle gravierenden Einwände nützen nichts: Menschen werden mit Intelligenztests weiterhin traktiert und taxiert.“ Ein lesenswerter Artikel mehr der zeigt, wie kritisch die IQ-Bewegung gesehen werden sollte. Möglicherweise zeigt die Multiple Intelligenzen Theorie in eine neue Richtung. Verschiedene Anzeichen sprechen meines Erachtens dafür. Siehe dazu die Beiträge in meinem MI-Blog.
In dem Beitrag geht es um die Irrungen der Intelligenzmessung: „Alle gravierenden Einwände nützen nichts: Menschen werden mit Intelligenztests weiterhin traktiert und taxiert.“ Ein lesenswerter Artikel mehr der zeigt, wie kritisch die IQ-Bewegung gesehen werden sollte. Möglicherweise zeigt die Multiple Intelligenzen Theorie in eine neue Richtung. Verschiedene Anzeichen sprechen meines Erachtens dafür. Siehe dazu die Beiträge in meinem MI-Blog.
ConWeaver: Eine Lösung zur Wissensvernetzung?
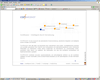 Die Ankündigung des Tools ConWeaver ist vielversprechend: „ConWeaver ist eine Lösung für die automatisierte Wissensvernetzung, semantische Integration und intelligente Suche in Portalen und Intranets.“ Um es gleich vorweg zu sagen: Ich bin sehr für die Nutzung der neuen technologischen Möglichkeiten, möchte aber dennoch auf die Besonderheiten von Wissen eingehen. Schauen wir uns zunächst den ersten Teil des Satzes an, in dem von „automatisierter Wissensvernetzung“ die Rede ist. Betrachtet man Wissen durch die Brille des Konstruktivismus´, so ist diese Aussage zu relativieren. Wenn Wissen situativ ist und in dem jeweiligen Kontext konstruiert wird, so leuchtet mir eine automatische Wissensvernetzung z. B. von impliziten Wissen mit Hilfe des Tools nicht ein. Weiterhin wird von einer „intelligenten Suche“ gesprochen. Scheinbar ist heute alles intelligent: Software, Häuser, Autos, Straßenschilder usw. Intelligenz ist ein Konstrukt, das über 100 Jahre von dem IQ bestimmt war. In der Zwischenzeit gibt es Alternativen, die zwar auch heftig kritisiert werden, aber doch immer stärker auf dem Vormarsch sind (Siehe den Hinweis von Rauner 2004, der auf die Konvergenz der Kompetenz- und Intelligenzdebatte verweist). Von welcher Art „Intelligenz“ wird hier in Verbindung mit dem Tool ConWeaver gesprochen? Ist es die künstliche Intelligenz (dann sollte man es auch so formulieren) oder meint man nur ein adaptives System? Und was ist mit den intelligenten Personen, die Wissen aus Daten und Informationen konstruieren, und es selbstorganisiert in Unternehmen (Domänen) so einsetzen, dass Probleme (Complex Problem Solving) des Kunden gelöst werden (Kompetenz: Selbstorganisationsdisposition)? Wie werden diese intelligenten Menschen von dem Tool unterstützt? Am Ende noch einmal der Hinweis: Ich bin für die Nutzung des Semantic Web, dennoch halte ich den Sprachgebrauch zur Zeit für etwas unglücklich.
Die Ankündigung des Tools ConWeaver ist vielversprechend: „ConWeaver ist eine Lösung für die automatisierte Wissensvernetzung, semantische Integration und intelligente Suche in Portalen und Intranets.“ Um es gleich vorweg zu sagen: Ich bin sehr für die Nutzung der neuen technologischen Möglichkeiten, möchte aber dennoch auf die Besonderheiten von Wissen eingehen. Schauen wir uns zunächst den ersten Teil des Satzes an, in dem von „automatisierter Wissensvernetzung“ die Rede ist. Betrachtet man Wissen durch die Brille des Konstruktivismus´, so ist diese Aussage zu relativieren. Wenn Wissen situativ ist und in dem jeweiligen Kontext konstruiert wird, so leuchtet mir eine automatische Wissensvernetzung z. B. von impliziten Wissen mit Hilfe des Tools nicht ein. Weiterhin wird von einer „intelligenten Suche“ gesprochen. Scheinbar ist heute alles intelligent: Software, Häuser, Autos, Straßenschilder usw. Intelligenz ist ein Konstrukt, das über 100 Jahre von dem IQ bestimmt war. In der Zwischenzeit gibt es Alternativen, die zwar auch heftig kritisiert werden, aber doch immer stärker auf dem Vormarsch sind (Siehe den Hinweis von Rauner 2004, der auf die Konvergenz der Kompetenz- und Intelligenzdebatte verweist). Von welcher Art „Intelligenz“ wird hier in Verbindung mit dem Tool ConWeaver gesprochen? Ist es die künstliche Intelligenz (dann sollte man es auch so formulieren) oder meint man nur ein adaptives System? Und was ist mit den intelligenten Personen, die Wissen aus Daten und Informationen konstruieren, und es selbstorganisiert in Unternehmen (Domänen) so einsetzen, dass Probleme (Complex Problem Solving) des Kunden gelöst werden (Kompetenz: Selbstorganisationsdisposition)? Wie werden diese intelligenten Menschen von dem Tool unterstützt? Am Ende noch einmal der Hinweis: Ich bin für die Nutzung des Semantic Web, dennoch halte ich den Sprachgebrauch zur Zeit für etwas unglücklich.
Malik: „Menschen nehmen wie sie sind“ in DIE WELT vom 04.11.2006
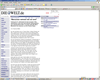 In seinem Beitrag in DIE WELT geht Prof. Malik darauf ein, dass sich Führung im 21. Jh. verändert hat. Hier einige (aus meiner subjektiven Sicht ausgewählte) Auszüge, die ich dann gerne mit Kommentaren versehen habe. Möglicherweise regt das ja zum Nachdenken an – würde mich freuen:
In seinem Beitrag in DIE WELT geht Prof. Malik darauf ein, dass sich Führung im 21. Jh. verändert hat. Hier einige (aus meiner subjektiven Sicht ausgewählte) Auszüge, die ich dann gerne mit Kommentaren versehen habe. Möglicherweise regt das ja zum Nachdenken an – würde mich freuen:
- Malik:“Ein erster Grundsatz muss lauten, Menschen dort einzusetzen, wo sie ihre Stärken haben“. Mein Kommentar: Ich frage mich, was hat man denn bisher gemacht, bzw. was macht man immer noch? Setzt man die Menschen denn zur Zeit nicht dort ein, wo sie ihre Stärken haben? Ein teurer Luxus…Aus meiner Sicht könnte hier die Multiple Intelligenzen Theorie von Gardner helfen (Siehe dazu auch meinen MI-Weblog bzw. das von mir initiierte EU-Projekt MIapp).
- Malik:“Wer als Manager im 21. Jahrhundert mit seinen schon vollzogenen und noch bevorstehenden Veränderungen erfolgreich sein will, muss als Wichtigstes lernen, dass nicht Macht entscheidend ist, sondern Kommunikation.“ Mein Kommentar: Ein Volltreffer. Damit fordert Prof. Malik allerdings auch ganz andere Unternehmen (soziale Systeme)…. Das zu fordern ist eine Sache, es in der Praxis um-, bzw. durchzusetzen eine andere. Dennoch: Es sollte das Ziel sein, Führungskräften diese Zusammenhänge immer wieder Bewusst zu machen.
- Malik:“Komplexitätsmanagement heißt, das Funktionieren eines Systems durch die Beeinflussung seiner Informationslage zu verändern.“ Mein Kommentar: Der Umgang mit Komplexität bedeutet, Selbstorganisationsdispositionen (Kompetenz) im Unternehmen zu ermöglichen und zu fördern. Aus meiner Sicht nicht nur Top-Down und in Zukunft vertärkt Bottom-Up. Letzeres wurde in der Vergangenheit aber leider vernachlässigt. Ein Monitoring (vgl. Schreyögg) führt zum notwendigen Abgleich.
Mass Customized Learning
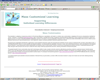 Auf der Website von Margaret Martinez & The Training Place finden Sie Hinweise darauf, wie Mass Customization auf den Bildungsbereich übertragen werden kann. Mass Customization wurde schon in vielen Branchen erfolgreich umgesetzt (Beispiele), warum nicht im Bildungsbereich? Für viele meiner Blogbesucher ist das nicht neu, da ich in vielen Vorträgen darauf hingewiesen habe, wie Mass Customization and Personalization im Bildungssektor umgesetzt werden kann. Beispielhaft hier einige meiner Vorträge:
Auf der Website von Margaret Martinez & The Training Place finden Sie Hinweise darauf, wie Mass Customization auf den Bildungsbereich übertragen werden kann. Mass Customization wurde schon in vielen Branchen erfolgreich umgesetzt (Beispiele), warum nicht im Bildungsbereich? Für viele meiner Blogbesucher ist das nicht neu, da ich in vielen Vorträgen darauf hingewiesen habe, wie Mass Customization and Personalization im Bildungssektor umgesetzt werden kann. Beispielhaft hier einige meiner Vorträge:
Freund, R. (2001): Mass Customization in der Bildung. Abschlusspräsentation im Juni 2001 an der Pädagogischen Hochschule Freiburg im Rahmen des berufsbegleitenden Studiums zum Experten für neue Lerntechnologien (FH) an der Teleakademie, Deutschland
Freund, R. (2003): Mass Customization and Personalization in der Weiterbildung. Vortrag auf der Konferenz forum 2: Perspektiven der Weiterbildung vom 17.-18.11.2003 in Berlin, Deutschland. Moderator: Prof. Herman Saterdag, Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur Rheinland-Pfalz, Mainz
Freund, R. (2003): Mass Customization in Education and Training . Vortrag (Speakers) auf der ElearnChina2003 in Edinburgh, Schottland
Freund, R., Piotrowski, M. (2003): Mass Customization and Personalization In Adult Education and Training. Vortrag auf dem 2. Weltkongress zu Mass Customization and Personalization MCPC2003 in München, Deutschland
Freund, R. (2005): Mass Customization in education and training. Rohmetra, N. (Ed) (2005): Human Resource Development : Challenges and Opportunities, New Dehli, India. Paper first presented at ElearnChina2003. ISBN 81-261-2326-5
Dabei ist allerdings einiges zu beachten. Ein Ansatz ist, Content in kleine Einheiten zu strukturieren (Learning Objects) und mit einem Konfigurator kundenindividuell zusammenzustellen (Customization, bzw. Mass Customization). Prof. Hutschreuter von der WHU in Vallendar hat 2002 dazu ein ausführliches Forschungspapier veröffentlicht. Wie das Prinzip funktioniert habe ich auf meiner Website beschrieben. Der Begriff „Learning Object“ ist allerdings ein wenig irreführend, denn Objects lernen nicht, sondern das Subjekt. Deshalb sollte man sich auch noch stärker dem Lernenden zuwenden (Teilnehmerorientiert, Personalisierung). Man kann die bisherige Entwicklung auf einen Punkt bringen: Von E minus Learning (E-Learning) zu Learning plus E (Learning + E). Lernprozesse sind also in Zukunft zu ermöglichen (Ermöglichungsdidaktik), wobei der Kontext in der betrieblichen Weiterbildung immer wichtiger wird (Konstruktivismus, Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition). Diese Sicht hat mich dazu bewegt, mich mit der Multiple Intelligenzen Theorie von Howard Gardner zu befassen, und was leztendlich zu dem von mir initiierten EU-Projekt MIapp (2004-2006) geführt hat. Dort untersuchen wir die Anwendungsmöglichkietn der MI-Theorie in verschiedenen Bereichen. Wenn Sie noch mehr dazu wissen wolle: Besuchen Sie auch meinen Blog zu MI. Dort finden Sie aktuelle Informationen.
Danfoss Universe und die Multiple Intelligenzen Theorie
 In dem International Report (The Washington Times 2006) wird zunächst auf die große Bedeutung der Bildung in Dänemark hingeweisen: „If education were a national currency, Denmark’s stock would be climbing fast. For good reason, Denmark invests eight percent of its Gross Domestic Product in education, more than any other country in the world.“ In diesem Licht verblassen alle wichtigen und unwichtigen Reden zum Thema Bildung in Deutschland (inkl. der Rede des Bundespräsidenten vom 21.09.2006). Weiterhin wird ausdrücklich auf eine Initiative der Firma Danfoss (Dänemark) hingewiesen: „Take Danfoss Universe, an investment in educating the next generation of Danes made by one of Denmark’s most successful business icons, Jorgen Mads Clausen, the CEO of Danfoss group. Clausen feels that education is the key to economic success and had a vision to start an experience park that promoted hands on learning through play.“ Beeindruckend ist dabei weiterhin, dass sich Danfoss ausdrücklich auf Gardner´s Multiple Intelligenzen Theorie bezieht: „For example, Harvard professor Howard Gardner, mastermind behind the theory that children are gifted with multiple intelligences, helped create ´Explorarama´, a section of Danfoss Universe. This hands on game facility challenges children in Gardner’s seven types of intelligences. When a child finishes exploring they are congratulated by a cartoon friend on a computer screen for being ´an awesome athlete´, or ´super creative´ based on their scores.“ Natürlich ist das hier angesprochene „scoring“ kritisch zu hinterfragen, denn man kommt leicht in die Versuchung, Multiple Intelligenzen wie den klassischen IQ zu messen. Das ist aber aus Sicht der Multiplen Intelligenzen Theorie nicht möglich. Andererseits sollte man diese Initiative unter der Überschrift sehen, dass auch in Europa immer mehr Organisationen (Bildungsinstitute und Unternehmen) die Vorteile der Multiplen Intelligenzen Theorie erkennen, und entsprechende Projekte initiieren.
In dem International Report (The Washington Times 2006) wird zunächst auf die große Bedeutung der Bildung in Dänemark hingeweisen: „If education were a national currency, Denmark’s stock would be climbing fast. For good reason, Denmark invests eight percent of its Gross Domestic Product in education, more than any other country in the world.“ In diesem Licht verblassen alle wichtigen und unwichtigen Reden zum Thema Bildung in Deutschland (inkl. der Rede des Bundespräsidenten vom 21.09.2006). Weiterhin wird ausdrücklich auf eine Initiative der Firma Danfoss (Dänemark) hingewiesen: „Take Danfoss Universe, an investment in educating the next generation of Danes made by one of Denmark’s most successful business icons, Jorgen Mads Clausen, the CEO of Danfoss group. Clausen feels that education is the key to economic success and had a vision to start an experience park that promoted hands on learning through play.“ Beeindruckend ist dabei weiterhin, dass sich Danfoss ausdrücklich auf Gardner´s Multiple Intelligenzen Theorie bezieht: „For example, Harvard professor Howard Gardner, mastermind behind the theory that children are gifted with multiple intelligences, helped create ´Explorarama´, a section of Danfoss Universe. This hands on game facility challenges children in Gardner’s seven types of intelligences. When a child finishes exploring they are congratulated by a cartoon friend on a computer screen for being ´an awesome athlete´, or ´super creative´ based on their scores.“ Natürlich ist das hier angesprochene „scoring“ kritisch zu hinterfragen, denn man kommt leicht in die Versuchung, Multiple Intelligenzen wie den klassischen IQ zu messen. Das ist aber aus Sicht der Multiplen Intelligenzen Theorie nicht möglich. Andererseits sollte man diese Initiative unter der Überschrift sehen, dass auch in Europa immer mehr Organisationen (Bildungsinstitute und Unternehmen) die Vorteile der Multiplen Intelligenzen Theorie erkennen, und entsprechende Projekte initiieren.
Project Based Learning and Multiple Intelligences
 Diese Website gibt sehr gute Anregungen zum projektbasierten Lernen mit Hilfe der Multiple Intelligenzen Theorie: „John Dewey theorized that learning should not only prepare one for life, but should also be an integral part of life itself. Simulating real problems and real problem-solving is one function of project based learning. Students help choose their own projects and create learning opportunities based upon their individual interests and strengths. Projects assist students in succeeding within the classroom and beyond, because they allow learners to apply multiple intelligences in completing a project they can be proud of. Our society values individuals who can solve problems creatively, using multiple strengths, so why shouldn’t we encourage students to do the same?“
Diese Website gibt sehr gute Anregungen zum projektbasierten Lernen mit Hilfe der Multiple Intelligenzen Theorie: „John Dewey theorized that learning should not only prepare one for life, but should also be an integral part of life itself. Simulating real problems and real problem-solving is one function of project based learning. Students help choose their own projects and create learning opportunities based upon their individual interests and strengths. Projects assist students in succeeding within the classroom and beyond, because they allow learners to apply multiple intelligences in completing a project they can be proud of. Our society values individuals who can solve problems creatively, using multiple strengths, so why shouldn’t we encourage students to do the same?“
