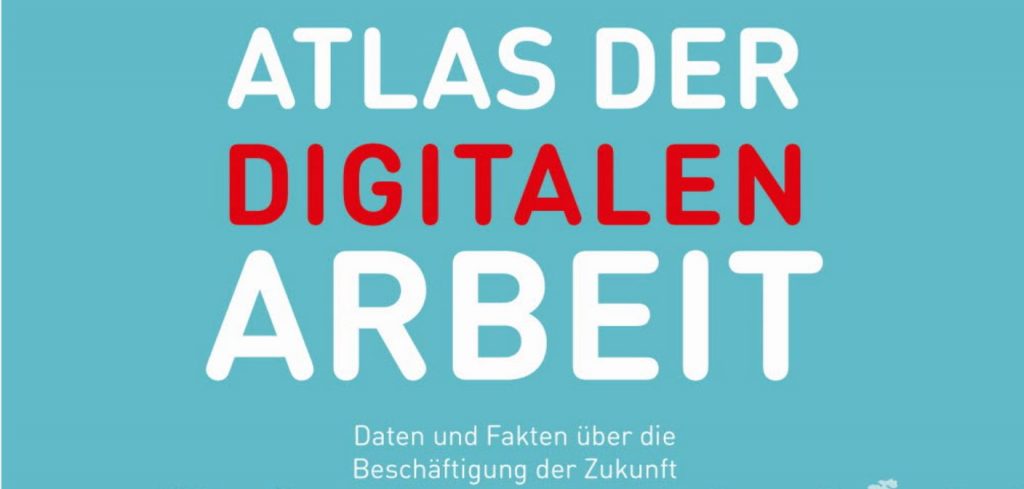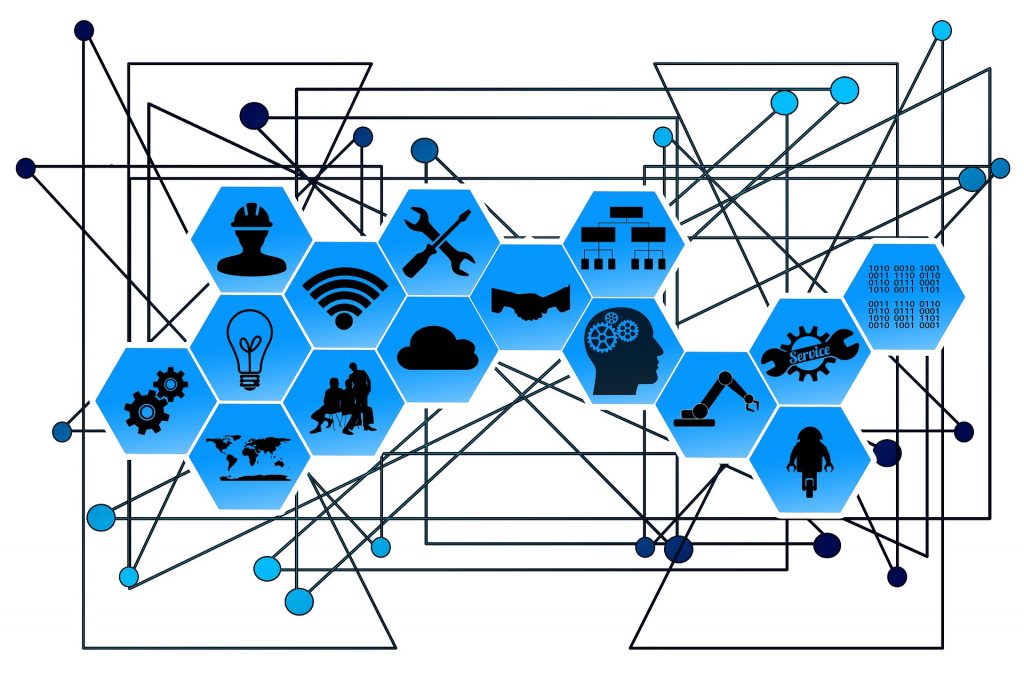Die Entwicklung zu den verschiedenen Normen und Standarddokumente zum Wissensmanagement ist in den letzten Jahren recht turbulent. Zunächst gibt es die Norm DIN ISO 30401:2021-02, Wissensmanagementsysteme — Anforderungen, die – wie die Bezeichnung es schon vermuten lässt – Anforderungen an Wissensmanagementsysteme formuliert. Darüber hinaus wurde die DIN SPEC 91281:2012-041, Einführung von prozessorientiertem Wissensmanagement in kleinen und mittleren Unternehmen zurückgezogen und dafür die DIN SPEC 91443:2021, Systematisches Wissensmanagement für KMU – Instrumente und Verfahren (PDF) veröffentlicht. Dieses Standarddokument soll die in der ISO beschriebenen Anforderungen auf die Bedürfnisse von KMU (Kleinen und mittelständischen Unternehmen) übertragen, und damit praktikabler machen: „Dieses Dokument legt Leitlinien für die Implementierung, Planung, Steuerung und Weiterentwicklung von systematischen Wissensmanagement-Aktivitäten fest, die speziell für die Bedarfe, Rahmenbedingungen und Kontexte kleiner und mittlerer Unternehmen ausgelegt sind“ (ebd., S. 6). Was wird in dem Standarddokument unter „Wissen“ verstanden?
Wissen: personales oder organisationales Asset, das wirksame Entscheidungen und Handlungen im Rahmen des Kontextes ermöglicht.
Anmerkung 1 zum Begriff: Wissen kann individuell, kollektiv oder organisational sein.
Anmerkung 2 zum Begriff: Es gibt unterschiedliche Auffassungen über den Umfang des Wissens, basierend auf Kontext und Zweck. Die vorstehende Definition ist in Bezug auf die verschiedenen Perspektiven allgemein gefasst. Beispiele für Wissen sind Erkenntnisse und Know-how.
Anmerkung 3 zum Begriff: Wissen wird durch Lernen oder durch Erfahrung angeeignet.
Anmerkung 4 zum Begriff: Im deutschen Sprachgebrauch wird Wissen auch als Ressource bezeichnet.
Anmerkung 5 zum Begriff: Wissen tritt in vielen Arten und in vielen Formen auf, die ein Kontinuum und Spektrum von klar kodifiziertem zu nicht kodifiziertem, erfahrungs- und/oder handlungsbasiertem Wissen darstellen.
Anmerkung 6 zum Begriff: Organisationales Wissen als Wertschöpfungs- und Produktionsfaktor wird aus ökonomischer Perspektive häufig auch als Intellektuelles Kapital bezeichnet. Es besteht aus Human-, Struktur- Beziehungskapital und
[QUELLE: DIN ISO 30401:2021-02, 3.25, modifiziert— Anmerkung 5 und Anmerkung 6 zum Begriff wurden hinzugefügt.]
An den verschiedenen Anmerkungen wird deutlich, dass „Wissen“ je nach Kontext verschiedene Facetten haben kann. Diese vielfältigen Dimensionen des Wissens sind zu gestalten (Wissensmanagement).
In den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen Projektmanager/in (IHK) und Projektmanager/in AGIL (IHK) haben wir Daten, Informationen und Wissen in einem projektorientierten und modernen Lernsetting so zusammengestellt, dass Sie die erforderlichen Kompetenzen für das IHK-Zertifikat entwickeln können. Informationen zu den Lehrgängen und zu Terminen finden Sie auf unserer Lernplattform.