Youtube-Video des Demographie-Netzwerks vom 05.05.2015.
Bitte schauen Sie sich dazu auch den von uns entwickelten blended Learning Lehrgang Wissensmanager/in (IHK) auf unserer Moodle-Lernplattform an.

KNOWLEDGE MAKES THE WORLD GO ROUND ®
Youtube-Video des Demographie-Netzwerks vom 05.05.2015.
Bitte schauen Sie sich dazu auch den von uns entwickelten blended Learning Lehrgang Wissensmanager/in (IHK) auf unserer Moodle-Lernplattform an.
 Die IHK Köln hat in verschiedenen Informationsflyer zusammengestellt, was unter dem IHK-Zertifikat zu verstehen ist, und welche Angebote es dazu gibt. In dem Flyer Management und Führung (PDF) finden Sie beispielsweise die von uns entwickelten Blended Learning Lehrgänge Projektmanager/in (IHK) und Innovationsmanager/in (IHK). In dem Flyer Trainer, Coaches, Berater (PDF) wird auf den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgang Wissensmanager/in (IHK) verwiesen. Weitere Informationen zu Angeboten finden Sie auf unserer Moodle-Lernplattform.
Die IHK Köln hat in verschiedenen Informationsflyer zusammengestellt, was unter dem IHK-Zertifikat zu verstehen ist, und welche Angebote es dazu gibt. In dem Flyer Management und Führung (PDF) finden Sie beispielsweise die von uns entwickelten Blended Learning Lehrgänge Projektmanager/in (IHK) und Innovationsmanager/in (IHK). In dem Flyer Trainer, Coaches, Berater (PDF) wird auf den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgang Wissensmanager/in (IHK) verwiesen. Weitere Informationen zu Angeboten finden Sie auf unserer Moodle-Lernplattform.
 Die Termine für unsere Blended Learning Lehrgänge Projektmanager/in (IHK), Innovationsmanager/in (IHK) und Wissensmanager/in (IHK) stehen nun für das zweite Halbjahr 2015 fest. Die Lehrgänge werden in Köln, Hagen, Lippstadt, Gera, Mannheim und Stuttgart angeboten. Auf unserer Moodle-Lernplattform finden Sie weitere Informationen, die jeweiligen Termine und die entsprechenden Ansprechpartner. Darüber hinaus können alle Angebote auch Inhouse gebucht werden. Natürlich können Sie sich bei Fragen auch an mich wenden, ich helfe gerne weiter. Es ist schön zu sehen, wie gut die jeweiligen Angebote angenommen werden, und wie gut die Resonanz bei den Teilnehmern ist: Was sagen Teilnehmer?
Die Termine für unsere Blended Learning Lehrgänge Projektmanager/in (IHK), Innovationsmanager/in (IHK) und Wissensmanager/in (IHK) stehen nun für das zweite Halbjahr 2015 fest. Die Lehrgänge werden in Köln, Hagen, Lippstadt, Gera, Mannheim und Stuttgart angeboten. Auf unserer Moodle-Lernplattform finden Sie weitere Informationen, die jeweiligen Termine und die entsprechenden Ansprechpartner. Darüber hinaus können alle Angebote auch Inhouse gebucht werden. Natürlich können Sie sich bei Fragen auch an mich wenden, ich helfe gerne weiter. Es ist schön zu sehen, wie gut die jeweiligen Angebote angenommen werden, und wie gut die Resonanz bei den Teilnehmern ist: Was sagen Teilnehmer?
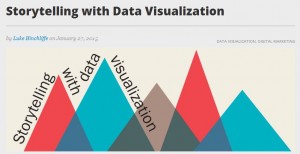 In Zeiten von Big Data, Open Data, Open Knowledge usw. ist es interessant sich anzusehen, wie aus der Fülle von Daten Informationen – und last but not least – Wissen werden kann (Wissenstreppe). Neue Technologien ermöglichen es uns heute, Daten in Formen zu übertragen, die den Übergang zu Informationen und Wissen erleichtern können. Der Beitrag Storytelling with Data Visulization vom 27.01.2015 fasst die Entwicklung gut zusammen. Stellt man Daten in einen ersten Kontext ergeben sich Zusammenhänge, die als Story weitertransportiert werden können. Ein so verstandenes Storytelling, das auf neuen Möglichkeiten der Datenvisualisierung basiert, erweitert die Möglichkeiten des klassischen Storytellings, das als ein wichtiges Instrument des modernen Wissensmanagements gelten kann. In dem von uns entwickelten Blended Learning Lehrgang Wissensmanager/in (IHK), gehe ich auf diese Zusammenhänge ein. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Moodle-Lernplattform.
In Zeiten von Big Data, Open Data, Open Knowledge usw. ist es interessant sich anzusehen, wie aus der Fülle von Daten Informationen – und last but not least – Wissen werden kann (Wissenstreppe). Neue Technologien ermöglichen es uns heute, Daten in Formen zu übertragen, die den Übergang zu Informationen und Wissen erleichtern können. Der Beitrag Storytelling with Data Visulization vom 27.01.2015 fasst die Entwicklung gut zusammen. Stellt man Daten in einen ersten Kontext ergeben sich Zusammenhänge, die als Story weitertransportiert werden können. Ein so verstandenes Storytelling, das auf neuen Möglichkeiten der Datenvisualisierung basiert, erweitert die Möglichkeiten des klassischen Storytellings, das als ein wichtiges Instrument des modernen Wissensmanagements gelten kann. In dem von uns entwickelten Blended Learning Lehrgang Wissensmanager/in (IHK), gehe ich auf diese Zusammenhänge ein. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Moodle-Lernplattform.
Die Entgrenzungen traditioneller Arbeitsverhältnisse ist kein temporäres Phänomen, sondern zeigt den Übergang zu vielfältigen, neuen Jobportfolios. In einer modernen Gesellschaft (Reflexive Modernisierung) sollten wir unser Verständnis von Arbeitszeit und Freizeit neu bestimmen, denn alles ist Lebenszeit. Es ist interessant zu beobachten, wie neue Lebens-, und damit Arbeitsformen, immer noch mit den traditionellen Normalarbeitsverhältnis verglichen werden. In Zukunft wird möglicherweise das normal sein, was in dem Film Digitale Nomaden angedeutet wird…

 Wer mehr Wissen möchte, schaut auf unsere Lernplattform. Hier finden Sie alle Hinweise zu unseren Blended Learning Lehrgängen – inkl. Termine und Orte. Die Buttons gibt es in unserem Spreadshirt – Shop .
Wer mehr Wissen möchte, schaut auf unsere Lernplattform. Hier finden Sie alle Hinweise zu unseren Blended Learning Lehrgängen – inkl. Termine und Orte. Die Buttons gibt es in unserem Spreadshirt – Shop .
![]() Der Blended Learning Lehrgang Wissensmanager/in (IHK) ist am Montag bei der IHK Köln gestartet. Es freut mich, dass das Interesse an Wissen und Wissensmanagement langsam aber sicher steigt. Am ersten Tag haben wir einige Grundlagen besprochen und eine Fallstudie bearbeitet. In dieser Woche hatten dann die Teilnehmer Gelegenheit, die Inhalte auf der Lernplattform zu vertiefen. Dabei bearbeiteten sie die Fallstudie – auch über die Lernplattform – weiter und beantworteten einige Einsende- und Onlineaufgaben. Sollten Sie an dem Lehrgang interessiert sein, so können Sie sich auf unserer Moodle-Lernplattform informieren.
Der Blended Learning Lehrgang Wissensmanager/in (IHK) ist am Montag bei der IHK Köln gestartet. Es freut mich, dass das Interesse an Wissen und Wissensmanagement langsam aber sicher steigt. Am ersten Tag haben wir einige Grundlagen besprochen und eine Fallstudie bearbeitet. In dieser Woche hatten dann die Teilnehmer Gelegenheit, die Inhalte auf der Lernplattform zu vertiefen. Dabei bearbeiteten sie die Fallstudie – auch über die Lernplattform – weiter und beantworteten einige Einsende- und Onlineaufgaben. Sollten Sie an dem Lehrgang interessiert sein, so können Sie sich auf unserer Moodle-Lernplattform informieren.
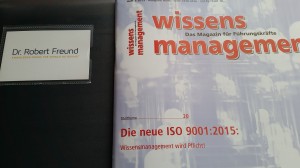 Wissensmanagement wird Pflicht! Das ist das Titelthema der Zeitschrift Wissensmanagement in der Ausgabe März 2015.Gemeint ist, dass die neue ISO 9001:2015 Unternehmen dazu „zwingt“, sich mehr mit Wissensmanagement zu befassen. Es gibt zwar eine Übergangsfrist, doch über kurz oder lang, wird Wissensmanagement „zur Pflicht!“ Doch wer kennt sich mit dem Thema aus? Gut, dass wir schon lange einen Blended Learning Lehrgang Wissensmanager/in (IHK) durchführen. Weitere Informationen gibt es auf unserer Moodle-Lernplattform.
Wissensmanagement wird Pflicht! Das ist das Titelthema der Zeitschrift Wissensmanagement in der Ausgabe März 2015.Gemeint ist, dass die neue ISO 9001:2015 Unternehmen dazu „zwingt“, sich mehr mit Wissensmanagement zu befassen. Es gibt zwar eine Übergangsfrist, doch über kurz oder lang, wird Wissensmanagement „zur Pflicht!“ Doch wer kennt sich mit dem Thema aus? Gut, dass wir schon lange einen Blended Learning Lehrgang Wissensmanager/in (IHK) durchführen. Weitere Informationen gibt es auf unserer Moodle-Lernplattform.
 Der Leitfaden Bitcom (2015): Kognitive Maschinen – Meilenstein in der Wissensarbeit zeigt deutlich auf, zu welchen Leistungen Cognitive Computing heute fähig ist. „Synonyme dafür bilden »Smart Machines« oder »intelligente Maschinen«. Cognitive Computing ist der Oberbegriff für die Gesamtheit aller IT-Infrastrukturen, Technologien, Softwarelösungen und Algorithmen, aus denen die »Cognitive Systems« zusammengesetzt werden, um »Cognitive Services« zu erbringen“ (S. 9). Die verschiedenen Beispiele erklären, welche Chancen sich ergeben können. Wir sollten daher nicht nur die Gefahren solcher Entwicklungen thematisieren, sondern auch die Chancen aktiv nutzen. Es wird deutlich, dass sich durch Cognitive Computing gerade auch die „einfache“ Wissensarbeit verändern wird. Die Kompetenzstufen Anfänger, Fortgeschrittener und Befähigter (Arbeiten, fakten- und regelbasiert sind) werden in Zukunft immer mehr von solchen Systemen abgelöst. Der Mensch ist allerdings im Vergleich zu Maschinen immer noch zur ganzheitlichen Wahrnehmung in der Lage, was dem Könner- oder Expertenniveau entspricht. Die Anforderungen an Wissensarbeiter steigen daher und haben Einfluss auf die Weiterbildung von Mitarbeitern.
Der Leitfaden Bitcom (2015): Kognitive Maschinen – Meilenstein in der Wissensarbeit zeigt deutlich auf, zu welchen Leistungen Cognitive Computing heute fähig ist. „Synonyme dafür bilden »Smart Machines« oder »intelligente Maschinen«. Cognitive Computing ist der Oberbegriff für die Gesamtheit aller IT-Infrastrukturen, Technologien, Softwarelösungen und Algorithmen, aus denen die »Cognitive Systems« zusammengesetzt werden, um »Cognitive Services« zu erbringen“ (S. 9). Die verschiedenen Beispiele erklären, welche Chancen sich ergeben können. Wir sollten daher nicht nur die Gefahren solcher Entwicklungen thematisieren, sondern auch die Chancen aktiv nutzen. Es wird deutlich, dass sich durch Cognitive Computing gerade auch die „einfache“ Wissensarbeit verändern wird. Die Kompetenzstufen Anfänger, Fortgeschrittener und Befähigter (Arbeiten, fakten- und regelbasiert sind) werden in Zukunft immer mehr von solchen Systemen abgelöst. Der Mensch ist allerdings im Vergleich zu Maschinen immer noch zur ganzheitlichen Wahrnehmung in der Lage, was dem Könner- oder Expertenniveau entspricht. Die Anforderungen an Wissensarbeiter steigen daher und haben Einfluss auf die Weiterbildung von Mitarbeitern.
Bitte informieren Sie sich dazu auf unserer Moodle-Lernplattform.
 Vielen ist es noch nicht klar: Die neuen Technologien vernetzen sehr, sehr viele Menschen und Dinge zu sagenhaft günstigen Kosten. Was sich so einfach anhört, hat allerdings für einzelne Menschen, Gruppen, Organisationen, Netzwerken und Gesellschaften erhebliche Auswirkungen. Und nicht nur das: Diese Auswirkungen geschehen in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit. In European Union (2015): Growing a Digital Social Innovation Ecosystem for Europe (PDF) wird zunächst erläutert, was unter Digital Social Innovation (DSI) zu verstehen ist (S. 4): „These range from social networks for those living with chronic health conditions, to online platforms for citizen participation in policymaking, to using´open data to create more transparency around public spending. We call this Digital Social Innovation (DSI).“ Dabei werden die vier folgenden Trends unterschieden:
Vielen ist es noch nicht klar: Die neuen Technologien vernetzen sehr, sehr viele Menschen und Dinge zu sagenhaft günstigen Kosten. Was sich so einfach anhört, hat allerdings für einzelne Menschen, Gruppen, Organisationen, Netzwerken und Gesellschaften erhebliche Auswirkungen. Und nicht nur das: Diese Auswirkungen geschehen in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit. In European Union (2015): Growing a Digital Social Innovation Ecosystem for Europe (PDF) wird zunächst erläutert, was unter Digital Social Innovation (DSI) zu verstehen ist (S. 4): „These range from social networks for those living with chronic health conditions, to online platforms for citizen participation in policymaking, to using´open data to create more transparency around public spending. We call this Digital Social Innovation (DSI).“ Dabei werden die vier folgenden Trends unterschieden:
Diese Trends werden dann auf europäischer Ebene dargestellt und in Hinblick auf Innovationen analysiert – interessant. Siehe dazu auch Innovationsmanager (IHK) und Wissensmanager (IHK) auf unserer Moodle-Lernplattform.