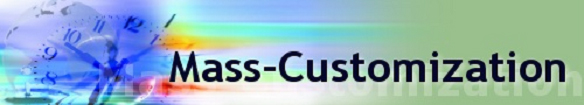
In den vergangenen Jahrzehnten ist ein deutlicher Trend in der Gesellschaft und in der Wirtschaft zu erkennen: Die Entgrenzung der ersten Moderne – mit ihren Rollen, Klassen und Systemen – führt in einer eher Reflexiven Modernisierung zu Entgrenzungen und zu mehr Individualisierung.
Der wirtschaftliche Teil der Entwicklung zeigt sich in immer stärker individualisierten Produkten und Dienstleistungen und in der Hybriden Wettbewerbsstrategie Mass Customization / Mass Personalization. Dabei wird sehr stark von dem Individuum ausgegangen, und die individuellen Bedürfnissen betrachtet. Der Soziologe Ulrich Beck sieht diesen Ansatz kritisch und begründet das wie folgt:
„Individualisierung allein, gleichsam als autistischer Massenindividualismus gedacht, ist ein Unbegriff, ein Unding. Individualisierung steht unter dem normativen Anspruch der Ko-Individualisierung, das heißt: der Individualisierung mit- oder gegeneinander. Aber die Individualisierung (der) des Einen ist oft genug die Grenze der Individualisierung des (der) Anderen. So werden mit zunehmender Individualisierung auch die nervigen Grenzen derselben mit erzeugt. Anders gesagt: Individualisierung ist ein durch und durch gesellschaftlicher Sachverhalt oder gar nichts. Die Vorstellung eines autarken Ich ist pure Ideologie“
Beck (2001): Das Zeitalter des „eigenen Lebens“. Individualisierung als „paradoxe Sozialstruktur“ und andere offene Fragen | PDF
Es macht nach Beck Sinn, den Blick auf den individuellen Bürger oder auch auf den individuellen Konsumenten stärker zusammen mit seinen Vernetzungen mit anderen zu sehen. Es zeigt sich auch hier wieder, wie eng soziologische und wirtschaftliche Bereiche vernetzt sind.


