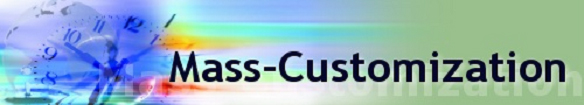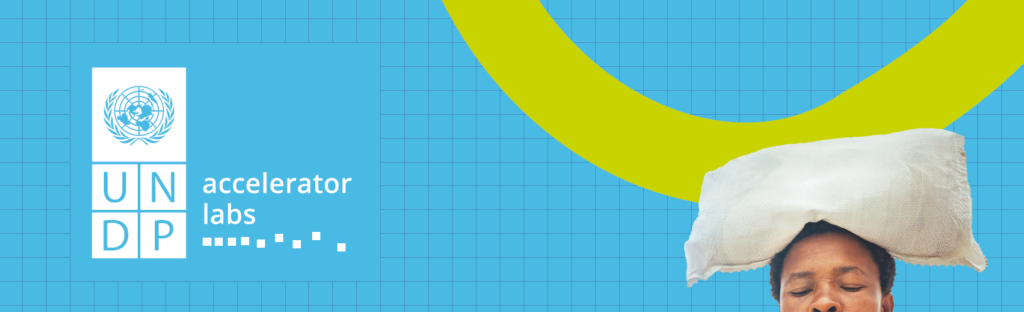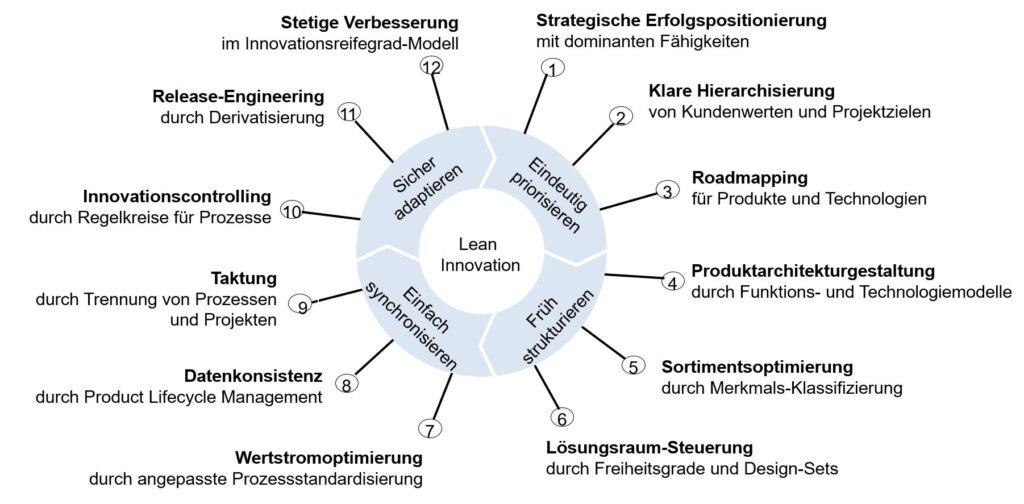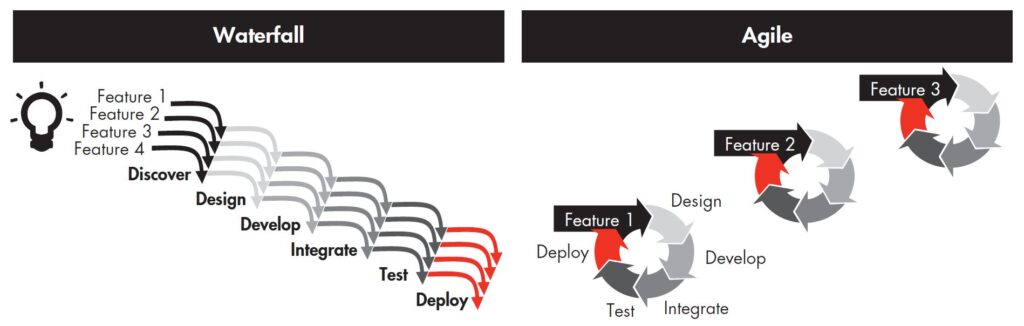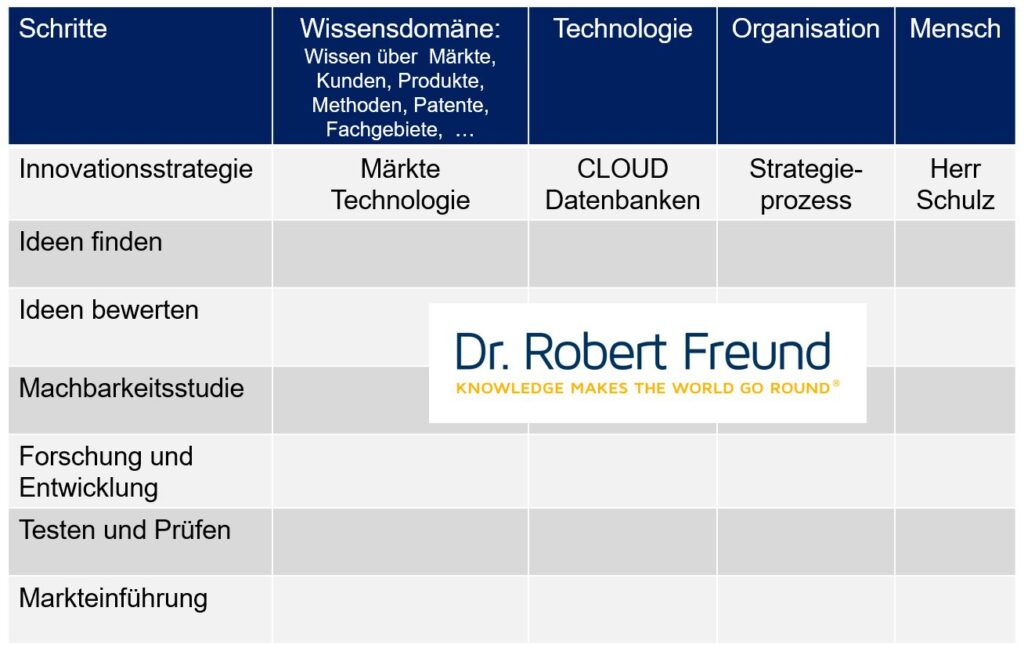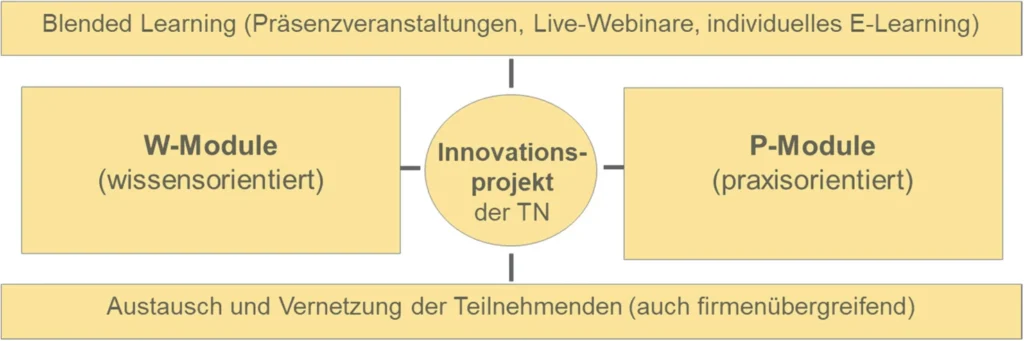In den letzten Jahrzehnten habe ich weltweit an vielen Konferenzen teilgenommen. Beispielhaft möchte ich hier nur die erste Weltkonferenz zu Mass Customization and Personalization MCPC 2001 an der Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), die MCPC 2003 in München, die MCPC 2007 am MIT in Boston, die MCPC 2015 in Montreal usw. nennen..
Überall konnte ich sehen, welche Themen die Forscher in ihren Veröffentlichungen vorstellten. Konferenzen sind daher ein vorlaufender Indikator für aktuelle und zukünftige Entwicklungen, auch für Innovationen. Solche Zusammenhänge hat Peter Drucker schon vor vielen Jahren aufgezeigt:
„Es wird allgemein angenommen, dass Innovationen grundsätzlich Veränderungen herbeiführen – doch nur die wenigsten leisten das. Erfolgreiche Innovationen machen sich Veränderungen zunutze, die schon stattgefunden haben. Sie nutzen beispielsweise den Time-lag – in der Wissenschaft macht dieser oft zwanzig bis dreißig Jahre aus – zwischen der Veränderung an sich und deren Auf- und Annahme. Während dieses Zeitraums muss der Nutznießer dieses Wandels kaum, wenn überhaupt, Konkurrenz befürchten“ (Drucker 1996).
Manche Themen wie die Entwicklung und Nutzung von Konfiguratoren im Rahmen der Hybriden Wettbewerbsstrategie Mass Customization, Problemlösungen zur Verschwendung in der Massenproduktion durch Personalisierung, oder die Nutzung von Additive Manufacturing (3D-Druck), usw. wurden in den letzten Jahrzehnten schon auf Konferenzen vorgestellt. Es dauerte dann doch noch viele Jahre, bis die Entwicklungen im Mainstream der Unternehmen ankamen.
Es ist eine Kunst, die auf Konferenzen aufgezeigten Themen und Problemlösungen für die eigene Organisation zum richtigen Zeitpunkt nutzbar zu machen, also als Innovationen anzubieten. Die von Drucker angesprochene Zeitspanne von 20-30 Jahren bietet hier die Möglichkeit, das richtige Timing zu finden. Zu früh mit Innovationen auf den Markt zu gehen, kann genau so negativ sein, wie Innovationen zu spät anzubieten.
Auf der Konferenz MCP 2026 haben Sie im September wieder die Möglichkeit, sich über die Themen (Mass) Customization und Personalization, sowie Open Innovation aus erster Hand zu informieren. Die von mir initiierte Konferenzreihe findet in diesem Jahr das 12. Mal statt, und zwar in Balatonfüred (Ungarn). Wir werden auch dabei sein.