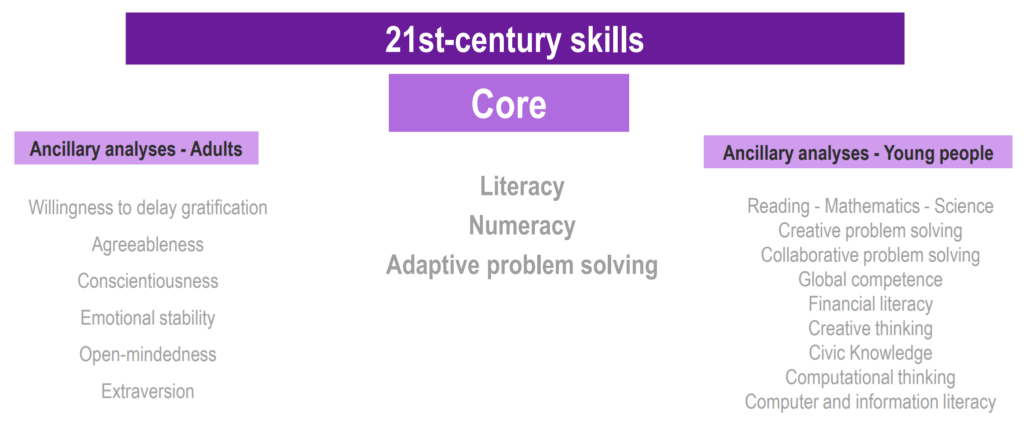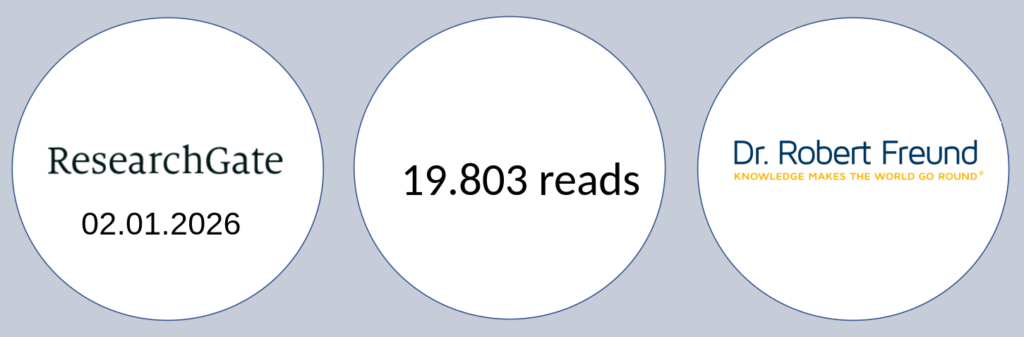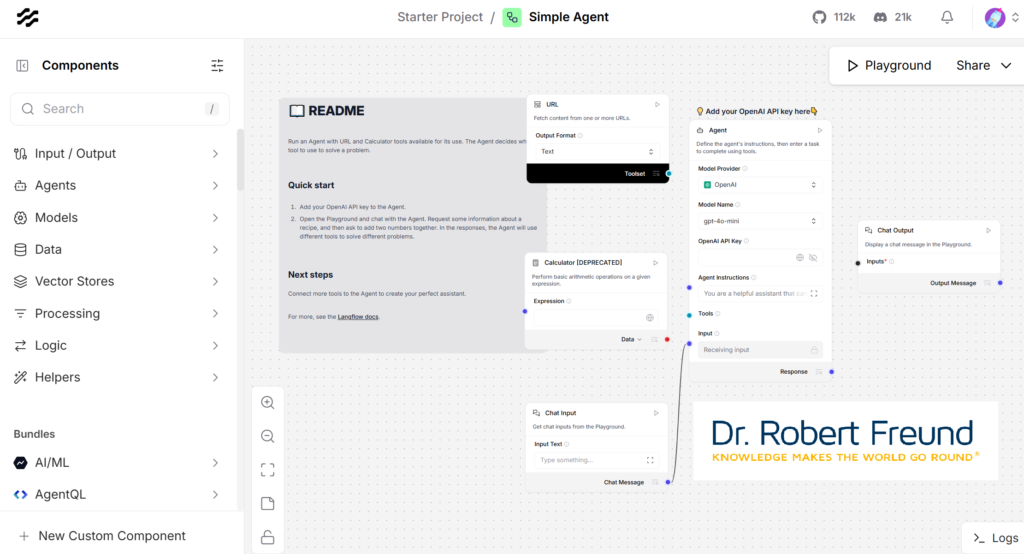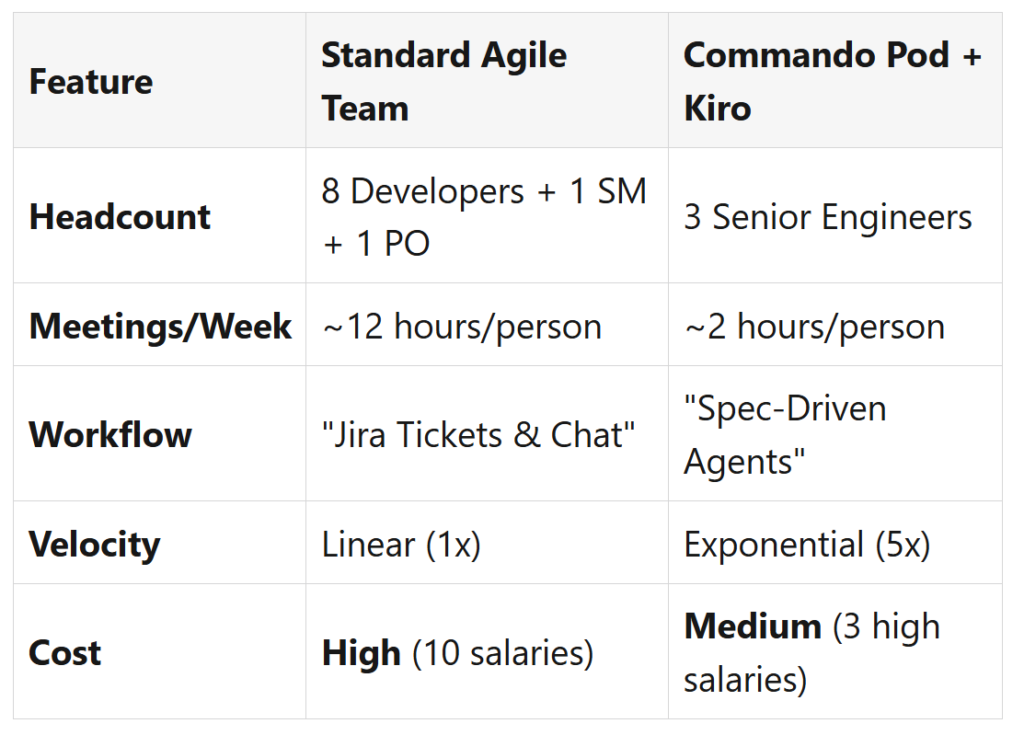Von der eher landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft, über die Industriegesellschaft und einer in den 1960er Jahren propagierten Wissensgesellschaft sind wir nach Erpenbeck/Heyse (2019) in einer Kompetenzgesellschaft gelandet. Siehe dazu auch Der Strukturbruch zwischen einfacher und reflexiver Modernisierung.
Kompetenzen als Selbstorganisationsdispositionen enthalten nach Erpenbeck (2012) „konstitutiv interiorisierte Regeln, Werte und Normen als Kompetenzkerne“.
Wenn Werte gleichzeitig als Ordner sozialer Komplexität angesehen werden können, liegt der Schluss nahe, dass wir uns stärker zu einer Art Wertegesellschaft entwickeln.
Da der Kern von Kompetenz also auch Werte beinhaltet, ist eine Kompetenzgesellschaft auch in gewisser Weise eine Wertegesellschaft.
Die Wertesystem der Europäischen Union ist die Basis für unser Zusammenleben – auch in Bezug auf Künstliche Intelligenz, oder in Abgrenzung zu anderen Wertesystemen weltweit.