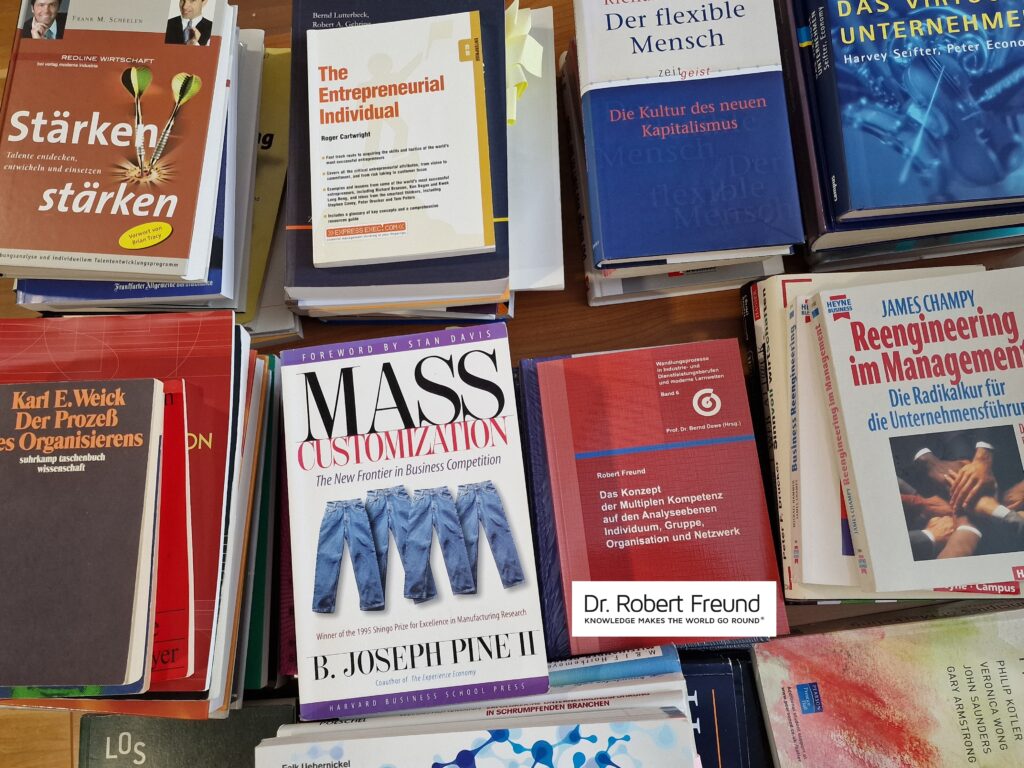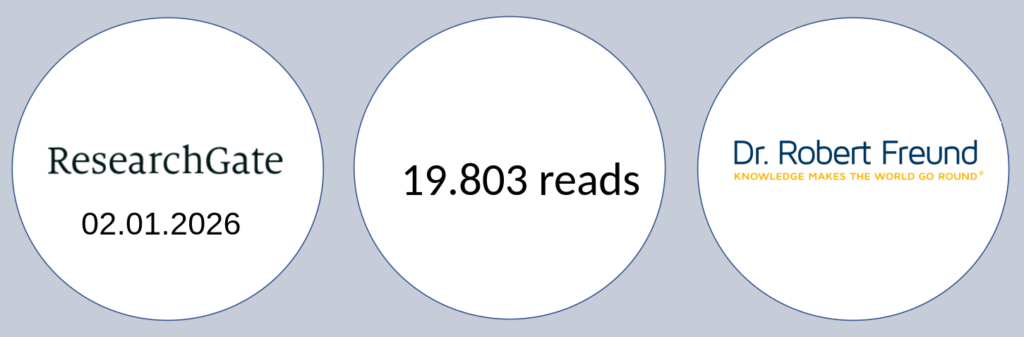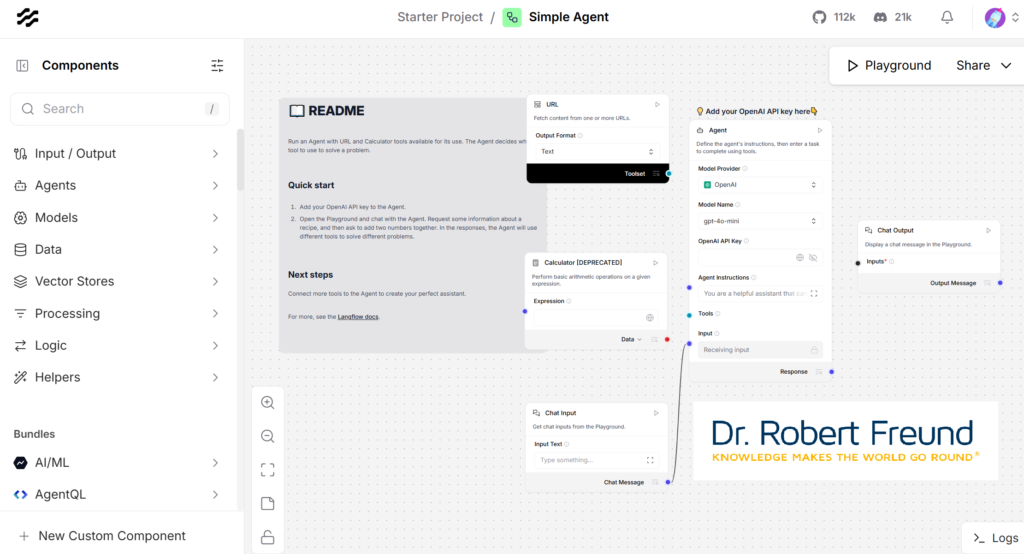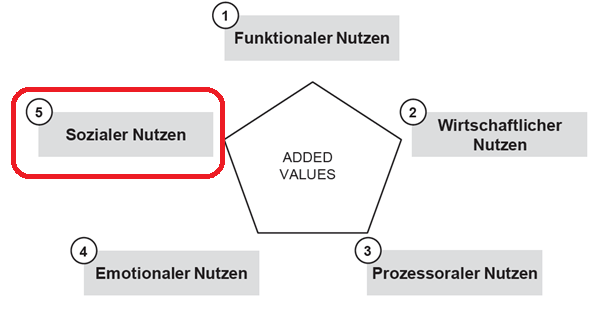In der Vergangenheit wurden immer wieder Begriffe/Wörter benutzt, die über die Zeit eine Wandlung/Weiterentwicklung erfahren haben. Das ist mit „Innovation“ oder auch mit „Qualität“ so – um nur diese beiden beispielhaft zu nennen.
Manchmal kann es auch sein, dass ein Wort wieder zu seiner ursprünglichen Bedeutung „zurückkehrt“. Schauen wir uns dazu einmal das Wort „Job“ an, das sehr oft benutzt wird, und heute auf eine Arbeitswelt trifft, in der Flexibilität eine große Rolle spielt.
„Das Wort „job“ bedeutete im Englischen des 14. Jahrhunderts einen Klumpen oder eine Ladung, die man herumschieben konnte. Die Flexibilität bringt diese vergessene Bedeutung zu neuen Ehren. Die Menschen verrichten Arbeiten wie Klumpen, mal hier, mal da. Es ist nur natürlich, dass diese Flexibilität Angst erzeugt. Niemand ist sich sicher, wie man mit dieser Flexibilität umgehen sollte, welche Risiken vertretbar sind, welchen Pfad man folgen sollte“ (Sennett 2002).
Es wird hier deutlich, dass Jobs im Vergleich zu eher langfristig angelegten Berufen kurzfristiger sind.: „Stellen werden durch Projekte und Arbeitsfelder ersetzt“ (ebd.). In der heutigen Arbeitswelt haben Jobs daher eine gute Passung zu iterativen, projektorientierten Arbeitsformen (New Work).
Das kommt den Unternehmen zu Gute, doch schüren Jobs auch Ängste, die in dem Zusammenhang zu wenig thematisiert werden.