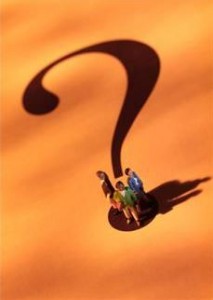 Die heutige Arbeitswelt hat sich starkt verändert. „The core competences of the knowledge age include creative problem solving, innovation the ability to work under pressure, and interpersonal, teamwork and leadership skills“ (Sallis/Jones 2002:80). In diesem Kontext kommt dem Lernen eine zentrale Bedeutung zu. Ein moderner Lernbegriff mit seinen vier Dimensionen (Dewe/Weber 2007) versteht Lernen als Problemlösungsprozess unter Unsicherheit und wird zur Basis eines entsprechenden Lernmanagements auf den Systemebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk (vgl. Pawlowsky 2003:75f.) in Unternehmen. Dadurch wird Lernen zum Lernmanagement und letztlich zum Kompetenzmanagement in den Organisationen (Zusammenhang). Zentraler Aspekt ist hier die Frage, wie gelernt wird, doch viele Mitarbeiter und Führungskräfte wissen darüber einfach zu wenig: „Success in the marketplace increasingly depends on people learning, yet most people do not know how to learn“ (Argyris 1998) oder „The rate at which organizations learn may become the only sutainable source of competitive advantage“ (Senge 1990) zeigen die Problematik auf. Ein Ansatz kann hier die Intelligenz bieten, da Intelligenz und Lernen über die Bewältigung einer (komplexen) Probelmlösung zusammenhängen. Arbeitsweltbezogenes Handeln – und die dafür erforderlichen Kompetenzen – stehen allerdings in engen Zusammenhang zu einem neuen Intelligenzverständnis, das zu diesen vielfältigen/multiplen Entwicklungen eine bessere Passung hat, als das reduzierte IQ-Verständnis. Dabei geht es nicht um ein entweder-oder sondern um ein sowohl-als-auch, also um ein integratives Verständnis von Intelligenz. Bei der Betrachtung der heutigen Arbeitsleistung reicht der IQ nicht mehr aus: “Die Triarchische Theorie (vgl. Sternberg 1984/1985) und die Multiple Intelligenzen Theorie (vgl. Gardner 1983/1993) sind auch dazu geeignet, Brücken zwischen den verschiedenen Ansätzen der Intelligenzforschung zu schlagen, und dem arbeitsweltbezogenen Handeln mit seiner Kontextabhängigkeit und Komplexität gerecht zu werden (vgl. Jez 2005:54). Beide Theorien integrieren damit bisher disparate Forschungsergebnisse und Theorien, wodurch sich ein neuer Rahmen für ein besseres Verständnis von menschlicher Intelligenz und Kompetenz ergeben kann (vgl. Kail/Pellegrino 1988:166). Siehe dazu auch Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk, Wen interessiert schon die Lerngeschwindigkeit?
Die heutige Arbeitswelt hat sich starkt verändert. „The core competences of the knowledge age include creative problem solving, innovation the ability to work under pressure, and interpersonal, teamwork and leadership skills“ (Sallis/Jones 2002:80). In diesem Kontext kommt dem Lernen eine zentrale Bedeutung zu. Ein moderner Lernbegriff mit seinen vier Dimensionen (Dewe/Weber 2007) versteht Lernen als Problemlösungsprozess unter Unsicherheit und wird zur Basis eines entsprechenden Lernmanagements auf den Systemebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk (vgl. Pawlowsky 2003:75f.) in Unternehmen. Dadurch wird Lernen zum Lernmanagement und letztlich zum Kompetenzmanagement in den Organisationen (Zusammenhang). Zentraler Aspekt ist hier die Frage, wie gelernt wird, doch viele Mitarbeiter und Führungskräfte wissen darüber einfach zu wenig: „Success in the marketplace increasingly depends on people learning, yet most people do not know how to learn“ (Argyris 1998) oder „The rate at which organizations learn may become the only sutainable source of competitive advantage“ (Senge 1990) zeigen die Problematik auf. Ein Ansatz kann hier die Intelligenz bieten, da Intelligenz und Lernen über die Bewältigung einer (komplexen) Probelmlösung zusammenhängen. Arbeitsweltbezogenes Handeln – und die dafür erforderlichen Kompetenzen – stehen allerdings in engen Zusammenhang zu einem neuen Intelligenzverständnis, das zu diesen vielfältigen/multiplen Entwicklungen eine bessere Passung hat, als das reduzierte IQ-Verständnis. Dabei geht es nicht um ein entweder-oder sondern um ein sowohl-als-auch, also um ein integratives Verständnis von Intelligenz. Bei der Betrachtung der heutigen Arbeitsleistung reicht der IQ nicht mehr aus: “Die Triarchische Theorie (vgl. Sternberg 1984/1985) und die Multiple Intelligenzen Theorie (vgl. Gardner 1983/1993) sind auch dazu geeignet, Brücken zwischen den verschiedenen Ansätzen der Intelligenzforschung zu schlagen, und dem arbeitsweltbezogenen Handeln mit seiner Kontextabhängigkeit und Komplexität gerecht zu werden (vgl. Jez 2005:54). Beide Theorien integrieren damit bisher disparate Forschungsergebnisse und Theorien, wodurch sich ein neuer Rahmen für ein besseres Verständnis von menschlicher Intelligenz und Kompetenz ergeben kann (vgl. Kail/Pellegrino 1988:166). Siehe dazu auch Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk, Wen interessiert schon die Lerngeschwindigkeit?
Stellt die Netzwerkfähigkeit einer Organisation ein eigenes Vermögen dar?
 Die vier zu betrachtenden Ebenen in einer Organisation sind: Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk. Dabei sind die Übergänge zwischen den einzelnen Ebenen besonders zu beachten. In komplexen Systemen kommt es an diesen Übergängen zu emergenten Phänomenen (Freund 2011). Auf der organisationalen Ebene stellt das Intellektuelle Kapital ein eigenes „Vermögen“ dar – genau so wie auf der Netzwerkebene:„Die Netzwerkfähigkeit und Zentralität eines Unternehmens wird dabei zu einem eigenständigen asset, zu sozialem Kapital, das umso wertvoller ist, je komplexer die Produkte und Dienstleistungen der Organisation sind und je schwieriger es ist, diese zu bewerten“ (Jansen 2006:272).
Die vier zu betrachtenden Ebenen in einer Organisation sind: Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk. Dabei sind die Übergänge zwischen den einzelnen Ebenen besonders zu beachten. In komplexen Systemen kommt es an diesen Übergängen zu emergenten Phänomenen (Freund 2011). Auf der organisationalen Ebene stellt das Intellektuelle Kapital ein eigenes „Vermögen“ dar – genau so wie auf der Netzwerkebene:„Die Netzwerkfähigkeit und Zentralität eines Unternehmens wird dabei zu einem eigenständigen asset, zu sozialem Kapital, das umso wertvoller ist, je komplexer die Produkte und Dienstleistungen der Organisation sind und je schwieriger es ist, diese zu bewerten“ (Jansen 2006:272).
Quelle: Jansen, D. (2006): Einführung in die Netzwerkanalyse. Grundlagen, Methoden, Forschungsbeispiele. VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
KRC Ordnungsrahmen für Wissensmanagement
 Das Knowledge Research Center (KRC e.V.) begründet die Notwendigkeit eines Ordnungsrahmens wie folgt: „Insbesondere fällt die mangelnde Kumulativität der Debatte auf. Statt von einer interdisziplinär-synergetischen Betrachtung zu profitieren, liegt eine heterogene Landschaft an Grundbegriffen, Modellen, Theorien und Instrumenten vor, welche in ihren Aussagen teilweise unvereinbar und konkurrierend zueinander stehen. Diese Probleme sind deutliche Anzeichen einer geringen wissenschaftlichen Reife des Forschungsfeldes – und das trotz extensiver Diskussionen und Forschungsaktivitäten.“ In dem Paper Lin; D.; Kruse, P.; Hetmank, L.; Geißler, P.; Schoop, E.; Ehrlich, S. (2013): Wie können wir die Verständlichkeit der forschungsorientierten Kommunikation verbessern? – Ein Ordnungsrahmen für den Diskurs im Wissensmanagement wird der Ansatz ausführlich dargestellt.
Das Knowledge Research Center (KRC e.V.) begründet die Notwendigkeit eines Ordnungsrahmens wie folgt: „Insbesondere fällt die mangelnde Kumulativität der Debatte auf. Statt von einer interdisziplinär-synergetischen Betrachtung zu profitieren, liegt eine heterogene Landschaft an Grundbegriffen, Modellen, Theorien und Instrumenten vor, welche in ihren Aussagen teilweise unvereinbar und konkurrierend zueinander stehen. Diese Probleme sind deutliche Anzeichen einer geringen wissenschaftlichen Reife des Forschungsfeldes – und das trotz extensiver Diskussionen und Forschungsaktivitäten.“ In dem Paper Lin; D.; Kruse, P.; Hetmank, L.; Geißler, P.; Schoop, E.; Ehrlich, S. (2013): Wie können wir die Verständlichkeit der forschungsorientierten Kommunikation verbessern? – Ein Ordnungsrahmen für den Diskurs im Wissensmanagement wird der Ansatz ausführlich dargestellt.
Explizites, implizites und bildhaftes Wissen
 Der folgende Absatz zeigt auf, dass es neben dem expliziten und impliziten Wissen auch noch das bildhafte Wissen gibt:
Der folgende Absatz zeigt auf, dass es neben dem expliziten und impliziten Wissen auch noch das bildhafte Wissen gibt:
„Bestens bekannt ist das explizite Wissen, das in Schulen genauso wie in Quiz-Shows im Vordergrund steht. Es ist das, was wir abfragen können. Wie heißt die Hauptstadt von Aserbaidschan? Wie viele Neuronen besitzt das menschliche Gehirn? Wie lautet die zweite binomische Formel? Aber können Sie erklären, welche Muskeln Sie nacheinander anspannen, um einen Golfschläger zu schwingen? Oder welche Prozesse ablaufen müssen, um einen Text zu schreiben? Oder was in unserem Unbewussten verborgen liegt? All diese Kenntnisse und Steuerungsmechanismen, die wir brauchen, um als Menschen zu funktionieren, die uns aber nicht bewusst werden, das ist das implizite Wissen. Dann gibt es noch einen dritten Bereich, das bildhafte Wissen. Es umfasst unser Vorstellungsvermögen genauso wie unser Erinnerungsvermögen an Bildern. Aber auch die eigenen Erlebnisse werden teilweise bildhaft festgehalten“ (Pöppel, E.; Wagner, B. 2012:48).
GfWM Themen Januar 2013 wieder mit spannenden Artikeln
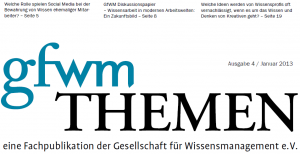 Die GfWM Themen Januar 2013 enthalten wieder interessante Beiträge. Einen möchte ich herausstellen, es ist das „GfWM Diskussionspapier – Wissensarbeit in modernen Arbeitswelten: Ein Zukunftsbild“. Es ist nicht ganz einfach, die moderne Arbeitswelt zu beschreiben, geschweige denn, ein Zukunftsbild zu entwerfen. Der Beitrag regt somit an, sich mit der Thematik Wissen und Arbeit (und den damit möglichen Kombinationen) intensiver zu beschäftigen – und das ist gut. Siehe dazu auch Wissensarbeiter und Unternehmen im Spannungsfeld, Organisationsformen der Wissensarbeit, Wissensbasierte Arbeit braucht neue Strukturen, Innovationsarbeit 2.0, Das Ganze der Arbeit, Kritik an dem Begriff Wissensarbeiter, Wirtschaftliches Handeln als soziales Handeln verstehen.
Die GfWM Themen Januar 2013 enthalten wieder interessante Beiträge. Einen möchte ich herausstellen, es ist das „GfWM Diskussionspapier – Wissensarbeit in modernen Arbeitswelten: Ein Zukunftsbild“. Es ist nicht ganz einfach, die moderne Arbeitswelt zu beschreiben, geschweige denn, ein Zukunftsbild zu entwerfen. Der Beitrag regt somit an, sich mit der Thematik Wissen und Arbeit (und den damit möglichen Kombinationen) intensiver zu beschäftigen – und das ist gut. Siehe dazu auch Wissensarbeiter und Unternehmen im Spannungsfeld, Organisationsformen der Wissensarbeit, Wissensbasierte Arbeit braucht neue Strukturen, Innovationsarbeit 2.0, Das Ganze der Arbeit, Kritik an dem Begriff Wissensarbeiter, Wirtschaftliches Handeln als soziales Handeln verstehen.
Wissenschaft etwas anders gesehen…
 In dem Artikel Die „vermessene“ Wissenschaft (FAZ vom 31.12.2012, S. 12) plädiert Hans Jörg Hennecke, Professor für Politikwissenschaft an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock, für eine „Rückbesinnung auf die persönliche Verantwortung in Politik und Wirtschaft“. Der Autor kritisiert die „exakten Naturwissenschaften“ und beschreibt diese Herangehensweise sehr doppeldeutig als „vermessen“. Welche Konsequenzen diese verengte Sichtweise auf hochkomplexe Situationen hat, zeigt Hennecke deutlich auf: „Das Erfahrungswissen, das implizite und verstreute Wissen und Werten Einzelner, wird von explizitem, konstrutivistischem Wissen und Werten des Staates verdrängt“. Ein Sowohl-als-auch wäre hier sinnvoller. Siehe dazu auch Die Welt bleibt unberechenbar und If you can not measure it, you can not manage it.
In dem Artikel Die „vermessene“ Wissenschaft (FAZ vom 31.12.2012, S. 12) plädiert Hans Jörg Hennecke, Professor für Politikwissenschaft an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock, für eine „Rückbesinnung auf die persönliche Verantwortung in Politik und Wirtschaft“. Der Autor kritisiert die „exakten Naturwissenschaften“ und beschreibt diese Herangehensweise sehr doppeldeutig als „vermessen“. Welche Konsequenzen diese verengte Sichtweise auf hochkomplexe Situationen hat, zeigt Hennecke deutlich auf: „Das Erfahrungswissen, das implizite und verstreute Wissen und Werten Einzelner, wird von explizitem, konstrutivistischem Wissen und Werten des Staates verdrängt“. Ein Sowohl-als-auch wäre hier sinnvoller. Siehe dazu auch Die Welt bleibt unberechenbar und If you can not measure it, you can not manage it.
Personales Wissen und organisationales Wissen intelligent vernetzen
 Wie Sie der Grafik entnehmen können, stellt Willke (2003) dem personalen Wissen (Laien, Facharbeiter, klassische Professionen, Experten) ein eher organisationales Wissen gegenüber, das auf individueller und systemischer Ebene Expertise darstellt. Die Vernetzung des Wissens von Experten in z.B. Projekten ist somit ein wichtiges Kennzeichen moderner Organisationsformen. Bezeichnend ist weiterhin, dass Willke dabei ausdrücklich auch den Intelligenzbegriff mit einbezieht. Allerdings wird hier der IQ erwähnt. Wie Sie wissen, würde ich diesen Ansatz etwas erweitern…. Siehe Multiple Intelligenzen und Multiple Kompetenzen.
Wie Sie der Grafik entnehmen können, stellt Willke (2003) dem personalen Wissen (Laien, Facharbeiter, klassische Professionen, Experten) ein eher organisationales Wissen gegenüber, das auf individueller und systemischer Ebene Expertise darstellt. Die Vernetzung des Wissens von Experten in z.B. Projekten ist somit ein wichtiges Kennzeichen moderner Organisationsformen. Bezeichnend ist weiterhin, dass Willke dabei ausdrücklich auch den Intelligenzbegriff mit einbezieht. Allerdings wird hier der IQ erwähnt. Wie Sie wissen, würde ich diesen Ansatz etwas erweitern…. Siehe Multiple Intelligenzen und Multiple Kompetenzen.

Termine 2013: Projektmanager (IHK), Innovationsmanager (IHK), Wissensmanager (IHK)
 Auch im kommenden Jahr 2013 werden wir wieder unsere Blended Learning Lehrgänge Projektmanager (IHK), Innovationsmanager (IHK) und Wissensmanager (IHK) bei verschiedenen IHK in Deutschland anbieten. Neu hinzugekommen ist ein Lehrgang Projektmanager klinische Studien (IHK), der auf unserem Basislehrgang aufbaut, und zusätzlich branchenspezifische Themen behandelt. Bitte informieren Sie sich auf der Seite Termine über die jeweiligen Angebote. Sollten Sie Fragen haben, so können Sie die dort angegebenen Ansprechpartner kontaktieren oder auch gerne mich ansprechen.
Auch im kommenden Jahr 2013 werden wir wieder unsere Blended Learning Lehrgänge Projektmanager (IHK), Innovationsmanager (IHK) und Wissensmanager (IHK) bei verschiedenen IHK in Deutschland anbieten. Neu hinzugekommen ist ein Lehrgang Projektmanager klinische Studien (IHK), der auf unserem Basislehrgang aufbaut, und zusätzlich branchenspezifische Themen behandelt. Bitte informieren Sie sich auf der Seite Termine über die jeweiligen Angebote. Sollten Sie Fragen haben, so können Sie die dort angegebenen Ansprechpartner kontaktieren oder auch gerne mich ansprechen.
IHK Köln: Projektmanager (IHK), Innovationsmanager (IHK) und Wissensmanager (IHK) im ersten Halbjahr 2013
 Im ersten Halbjahr 2013 bieten wir unsere Blended Learning Lehrgänge auch wieder bei der IHK Köln an. Neu im Angebot ist diesmal der Wissensmanager (IHK). Teilnehmer aus den Lehrgängen Projektmanager (IHK) und Innovationsmanager (IHK) hatten immer wieder nach dem Angebot gefragt – nun ist es da:
Im ersten Halbjahr 2013 bieten wir unsere Blended Learning Lehrgänge auch wieder bei der IHK Köln an. Neu im Angebot ist diesmal der Wissensmanager (IHK). Teilnehmer aus den Lehrgängen Projektmanager (IHK) und Innovationsmanager (IHK) hatten immer wieder nach dem Angebot gefragt – nun ist es da:
Projektmanager (IHK)
- 16.01.-27.02.2013
- 10.04.-22.05.2013
- 29.05.-03.07.2013
Innovationsmanager (IHK)
- 30.04.-04.06.2013
Wissenssmanager (IHK)
- 11.06.-16.07.2013
Informationen zu diesen Lehrgängen – und zu weiteren Angeboten bei anderen IHK – finden Sie unter Termine.
SIHK Hagen: Wissensmanager (IHK) und Projektmanager (IHK) im ersten Halbjahr 2013
 Im ersten Halbjahr 2013 bieten wir bei der SIHK in Hagen folgende Blended Learning Lehrgänge an: Wissensmanager (IHK): 15.02.-22.03.2013 und Projektmanager (IHK): 12.04.-24.05.2013. Informationen zu diesen Lehrgängen und zu weiteren Angeboten bei anderen IHK finden Sie unter Termine.
Im ersten Halbjahr 2013 bieten wir bei der SIHK in Hagen folgende Blended Learning Lehrgänge an: Wissensmanager (IHK): 15.02.-22.03.2013 und Projektmanager (IHK): 12.04.-24.05.2013. Informationen zu diesen Lehrgängen und zu weiteren Angeboten bei anderen IHK finden Sie unter Termine.
