 In dem Essay Du bist Elite schreibt Detlef Gürtler heute in DIE WELT über die Vergeudung von Potenzialen in Deutschland. Neben einigen Allgemeinplätzen wie „Der entscheidende, der einzige Rohstoff, über den Deutschland verfügt, sind seine Menschen, und in der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts“ findet man auch differenziertere Beurteilungen: „Je besser Menschen in der Lage sind, ihre Einzigartigkeit zu entwickeln, ihre Besonderheit zu betonen, desto höher ihre Erträge und desto höher auch die Produktivität der Gesellschaft.“ Es wird deutlich, dass die wissensbasierte Gesellschaft nicht nur Akademiker braucht, sondern die Potenziale auf allen Ebenen erschlossen werden sollten. Dazu gehört auch eine entsprechende Entlohnung. In Deutschland werden immer noch die Leistungen (Wertschöpfungen), die direkt am Kunden erbracht werden (Verkäuferinnen, Pflegedienste, usw.) am schlechtesten bezahlt. Berechtigt fragt der Autor deshalb: „Aber wo sind die Exzelenzinitiativen für Ingenieure, für Werkzeugmacher, für Tischler?“ Deutschland hat „einen immensen Nachhobedarf an Investitionen bei der Investition in Menschen, in Köpfe, in Humankapital.“ Der Autor hat mit diesem Essay einen wichtigen Beitrag geliefert, da der Artikel die Elite-, bzw. Exzellenzdiskussion erweitert und auf die vielen unterschiedlichen Potenziale von Menschen verweist. Wie Sie als Leser meines Blog wissen, favorisiere ich die Multiple Intelligenzen Theorie, um die Potenziale von Menschen zu erschließen. Es scheint der richtige Weg zu sein …
In dem Essay Du bist Elite schreibt Detlef Gürtler heute in DIE WELT über die Vergeudung von Potenzialen in Deutschland. Neben einigen Allgemeinplätzen wie „Der entscheidende, der einzige Rohstoff, über den Deutschland verfügt, sind seine Menschen, und in der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts“ findet man auch differenziertere Beurteilungen: „Je besser Menschen in der Lage sind, ihre Einzigartigkeit zu entwickeln, ihre Besonderheit zu betonen, desto höher ihre Erträge und desto höher auch die Produktivität der Gesellschaft.“ Es wird deutlich, dass die wissensbasierte Gesellschaft nicht nur Akademiker braucht, sondern die Potenziale auf allen Ebenen erschlossen werden sollten. Dazu gehört auch eine entsprechende Entlohnung. In Deutschland werden immer noch die Leistungen (Wertschöpfungen), die direkt am Kunden erbracht werden (Verkäuferinnen, Pflegedienste, usw.) am schlechtesten bezahlt. Berechtigt fragt der Autor deshalb: „Aber wo sind die Exzelenzinitiativen für Ingenieure, für Werkzeugmacher, für Tischler?“ Deutschland hat „einen immensen Nachhobedarf an Investitionen bei der Investition in Menschen, in Köpfe, in Humankapital.“ Der Autor hat mit diesem Essay einen wichtigen Beitrag geliefert, da der Artikel die Elite-, bzw. Exzellenzdiskussion erweitert und auf die vielen unterschiedlichen Potenziale von Menschen verweist. Wie Sie als Leser meines Blog wissen, favorisiere ich die Multiple Intelligenzen Theorie, um die Potenziale von Menschen zu erschließen. Es scheint der richtige Weg zu sein …
Innovationsindikator 2007: Kaum Verbesserungen festzustellen
 Auf der Website Innovationsindikator Deutschland findet man den ausführlichen Innovationsindikator 2007 (4,4 MB, pdf): „Der Innovationsindikator Deutschland bewertet die Innovationsfähigkeit nicht nur auf Basis harter Daten und Fakten, sondern auch als ökonomisches, technisches und gesellschaftliches Phänomen.“ Im Vergleich zum Innovationsindikator 2006 sind die Beurteilungen in vielen Bereichen schlechter geworden – trotz aller Ermahnungen von Politik und Wirtschaft. Ein wesentliches Kriterium von Innovation ist eben die Umsetzung. Frei nach Goethe: Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch wollen. Es ist nicht genug zu können, man muss auch tun.
Auf der Website Innovationsindikator Deutschland findet man den ausführlichen Innovationsindikator 2007 (4,4 MB, pdf): „Der Innovationsindikator Deutschland bewertet die Innovationsfähigkeit nicht nur auf Basis harter Daten und Fakten, sondern auch als ökonomisches, technisches und gesellschaftliches Phänomen.“ Im Vergleich zum Innovationsindikator 2006 sind die Beurteilungen in vielen Bereichen schlechter geworden – trotz aller Ermahnungen von Politik und Wirtschaft. Ein wesentliches Kriterium von Innovation ist eben die Umsetzung. Frei nach Goethe: Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch wollen. Es ist nicht genug zu können, man muss auch tun.
KAM 2007: Knowledge Assessment Methodology (Updated)
 Wollen Sie wissen, wie Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern steht? Dann sind Sie bei KAM richtig: „The KAM is an interactive benchmarking tool created by the Knowledge for Development Program to help countries identify the challenges and opportunities they face in making the transition to the knowledge-based economy.“ Immerhin von 140 Ländern. Nun liegt ein Update vor. Dabei sind der Knowledge Economy Index (KEI) und der Knowledge Index (KI) interessante Werte. Schauen Sie sich diese doch einmal in der Übersicht an. Heute (28.10.2007) lag Deutschland auf Rang 15 und Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland auf den Plätzen 1-4…
Wollen Sie wissen, wie Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern steht? Dann sind Sie bei KAM richtig: „The KAM is an interactive benchmarking tool created by the Knowledge for Development Program to help countries identify the challenges and opportunities they face in making the transition to the knowledge-based economy.“ Immerhin von 140 Ländern. Nun liegt ein Update vor. Dabei sind der Knowledge Economy Index (KEI) und der Knowledge Index (KI) interessante Werte. Schauen Sie sich diese doch einmal in der Übersicht an. Heute (28.10.2007) lag Deutschland auf Rang 15 und Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland auf den Plätzen 1-4…
Heisig, P. (2007): Professionelles Wissensmanagement in Deutschland
Peter Heisig stellt in seinem Artikel Professionelles Wissensmanagement in Deutschland den aktuellen Stand der Diskussion dar. Dabei wird deutlich, dass Wissensmanagement sich permanent weiterentwickelt. Neben den zukünftigen Trends im Wissensmanagement (nach einer amerikanischen Studie) wird eine Zusammenfassung von Geiger (2006) zitiert, in der philosophische Ansätze zu „Wissen“ von Habermas, Toulmin, Lyotard und Faucault auf folgenden Nenner gebracht werden:
(1) „Wissen ist immer originär sprachlich verfasst, (…). Außerhalb von Sprache kann es kein Wissen geben!
(2) Wissen ist immer sozial konstruiert und bemisst seine Güte niemals an der mit einer wie auch immer gearteten außerhalb des Wissens liegenden Realität. (…).
(3) Wissen muss immer ein sozial anerkanntes Prüfverfahren durchlaufen haben. (…)
(4) Wissen ist immer sozial, nie rein individuell. Da Wissen (…) einem sozial anerkannten Prüfverfahren genügen muss, kann nur eine Gemeinschaft über die Gültigkeit von Wissen entscheiden, nicht ein Individuum. Nur Gemeinschaften können sozusagen das Attribut Wissen verleihen.“
Eine enge Auslegung des Konstrukts „Wissen“ mit Konsequenzen … Siehe dazu auch Schreyögg/Geiger (2001): Kann implizites Wissen Wissen sein? In dem Vortrag werden die Grundzüge der Überlegungen von Geiger (2006) hergeleitet und thematisiert.
iD2010: Informationsgesellschaft Deutschland 2010
 Die Broschüre iD2010: Informationsgesellschaft Deutschland 2010 (Stand: November 2006) zeigt deutlich auf, dass die Informations- und Kommunikations-Technologie (IKT) eine wichtige Voraussetzung für wissensbasierte Strukturen ist (Unternehmen, Regionen, Länder, …). Betrachtet man die Wissenstreppe so wird deutlich, dass es noch ein weiter Weg ist, von der hier propagierten Informationsgesellschaft zur Wissensgesellschaft, die von der Bundesregierung im Hauptprogramm für die Wissensgesellschaft (Stand März 2002) skizziert wurde. Es ist zu empfehlen, alle Bereiche der Wissenstreppe im Auge zu behalten, und gerade auf die Übergänge zu achten…
Die Broschüre iD2010: Informationsgesellschaft Deutschland 2010 (Stand: November 2006) zeigt deutlich auf, dass die Informations- und Kommunikations-Technologie (IKT) eine wichtige Voraussetzung für wissensbasierte Strukturen ist (Unternehmen, Regionen, Länder, …). Betrachtet man die Wissenstreppe so wird deutlich, dass es noch ein weiter Weg ist, von der hier propagierten Informationsgesellschaft zur Wissensgesellschaft, die von der Bundesregierung im Hauptprogramm für die Wissensgesellschaft (Stand März 2002) skizziert wurde. Es ist zu empfehlen, alle Bereiche der Wissenstreppe im Auge zu behalten, und gerade auf die Übergänge zu achten…
Wilkesmann, M.; Wilkesmann, U.; Rascher, I.; Kopp, R.; Heisig, P. (2007): Wissensmanagement-Barometer
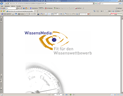 In der Studie Wissensmanagement-Barometer geht es um den Vergleich des IT-gestützten Wissensmanagements in verschiedenen Ländern. Die länderspezifischen Vergleiche bieten einen guten Überblick über den keweiligen Stand der Umsetzung im Vergleich zu Deutschland. Zusammenfassend werden folgende Punkte auf Seite 94 festgehalten:
In der Studie Wissensmanagement-Barometer geht es um den Vergleich des IT-gestützten Wissensmanagements in verschiedenen Ländern. Die länderspezifischen Vergleiche bieten einen guten Überblick über den keweiligen Stand der Umsetzung im Vergleich zu Deutschland. Zusammenfassend werden folgende Punkte auf Seite 94 festgehalten:
- Menschliche und organisatorische Rahmenbedingungen werden in den meisten Ländern als relevant eingestuft, jedoch kaum umgesetzt (Soll/Ist-Differenz).
- IT-Tools zum Wissensmanagement sind in Deutschland sehr ausgereift, aber im Vergleich zu anderen westlichen Industrieländern nur mittelmäßig verbreitet.
- Neuere Kontrollinstrumente (Wissensbilanzen, Zielvereinbarungen) spielen in Deutschland eine vergleichsweise große Rolle.
- Beim Verhältnis von Mensch-Technik-Organisation ist der Faktor Mensch vergleichsweise gering ausgeprägt.
Es gibt also schon gute Ansätze, dennoch sollte der Mensch aus meiner Sicht noch stärker bei der Umsetzung von Wissensmanagement-Konzepten in den Mittelpunkt der Überlegungen gestellt werden.
Internes Wissen kennen, bewerten und als „Kooperationswährung“ einbringen
Der Chefökonom der Deutschen Bank (Norbert Walter) schreibt heute in der Welt am Sonntag. Unter der Überschrift Glück auf, Deutschland findet man folgenden interessanten Abschnitt: „Für den einzelnen mittelständischen Unternehmer mag etwa die Entwicklung neuer, umfangreicher Wasseraufbereitungssysteme oft finanziell zu riskant, die Wissensanforderungen zu breit sein. In einem gemeinsamen Projekt mit anderen Spezialisten können jedoch beide Hürden überwunden werden. Und das gelingt umso besser, je genauer jeder Teilnehmer sein internes Wissen kennt und bewertet, um es als ´Kooperationswährung“ in ein gemeinsames Projekt einzubringen. Eine solche Projektwirtschaft bringt jene Teams hervor, die das schier Unmögliche – wie die Weltumrundung mit dem solarbetriebenen Flugzeug – schaffen. Glück auf, Deutschland!“ Es ist schön, dass auch Banker erkennen, dass das Wissen in mittelständischen Unternehmen stärker berücksichtigt werden muss – von den Unternehmen, aber auch von den Bankern selbst…
Deutschland führend in der Kompetenzdebatte? Wen interessiert das?
Die Kompetenzdebatte hat sich über die letzten Jahrzehnte ziemlich weiterentwickelt. Ich habe oftmals den Eindruck, als ob viele den Begriff „Kompetenz“ nicht mehr hören können, was ich durchaus verstehen kann. Der Begriff hat eine wechselvolle Geschichte und steht heute wieder im Mittelpunkt vieler Diskussionen. Dabei kann man schön sehen/lesen/hören, dass oftmals von ganz unterschiedlichen Konstrukten ausgegangen wird – dennoch wird heiß diskutiert – und diskutiert doch oftmals aneinander vorbei. In Deutschland haben wir den unschätzbaren Vorteil, dass mit dem QUEM-Projekt eine solide Basis für die weitere Entwicklung der Kompetenzdebatte gelegt wurde. Ausgehen von den Überlegungen John Erpenbeck´s kann man die vielfältigen Möglichkeiten des heutigen Ansatzes Nutzen. In einem Vortrag am 15.11.2006 in Frankfurt/Main sagte Erpenbeck, dass Deutschland in der Kompetenzdebatte führend ist – und ich darf anmerken: Keiner merkt es. Beeindruckend.
Innovationsindikator Deutschland 2006
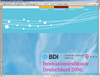 Der Innovationsindikator Deutschland 2006 zeigt (wieder einmal) auf, wo wir unsere Stärken (Markterfolge mit Produkten der Hochtechnologie usw.), aber auch, wo wir unsere Schwächen (u. a. Bildung) haben. Dass gerade in Zeiten eines stärker werdenden Wissenswettbewerbs Lernprozesse im Mittelpunkt stehen sollten, liegt auf der Hand. Allerdings habe ich oftmals den Eindruck, als ob alle Akteure unter dem Begriff Bildung etwas anderes verstehen. Bildung im Kontext einer Industriegesellschaft bedeutet etwas anderes als Bildung in einer stärker wissensbasierten Gesellschaft. Es wäre daher besser, den Bildungsbegriff aus der Diskussion zu nehmen und stärker von (selbstorganiserten) Lernprozessen zu sprechen. Leider haben das viele Entscheidungsträger noch nicht verinnerlicht und geben daher auf neue Fragen alte Antworten. Siehe dazu auch Bildung neu denken.
Der Innovationsindikator Deutschland 2006 zeigt (wieder einmal) auf, wo wir unsere Stärken (Markterfolge mit Produkten der Hochtechnologie usw.), aber auch, wo wir unsere Schwächen (u. a. Bildung) haben. Dass gerade in Zeiten eines stärker werdenden Wissenswettbewerbs Lernprozesse im Mittelpunkt stehen sollten, liegt auf der Hand. Allerdings habe ich oftmals den Eindruck, als ob alle Akteure unter dem Begriff Bildung etwas anderes verstehen. Bildung im Kontext einer Industriegesellschaft bedeutet etwas anderes als Bildung in einer stärker wissensbasierten Gesellschaft. Es wäre daher besser, den Bildungsbegriff aus der Diskussion zu nehmen und stärker von (selbstorganiserten) Lernprozessen zu sprechen. Leider haben das viele Entscheidungsträger noch nicht verinnerlicht und geben daher auf neue Fragen alte Antworten. Siehe dazu auch Bildung neu denken.
Deutschland hat große Stärken: Interview mit Klaus Kretschmann, Chefvolkswirt der EU (DIE WELT vom 09.10.2006)
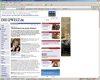 In dem Interview mit Klaus Kretschmann, Chefvolkswirt der EU, werden neben den bekannten Schwächen auch die hervorragenden Stärken von Deutschland benannt: „Deutschland hat große Stärken. Auf dem europäischen Innovationsindex gehört Deutschland mit Blick auf die Schaffung und Umsetzung von Wissen zu den führenden vier Ländern (…). Die Aktivierung von Wissen durch Forschung, Ausbildung und Unternehmertum ist unsere einzige Chance. Europas Zukunft liegt in der Wissensökonomie.“
In dem Interview mit Klaus Kretschmann, Chefvolkswirt der EU, werden neben den bekannten Schwächen auch die hervorragenden Stärken von Deutschland benannt: „Deutschland hat große Stärken. Auf dem europäischen Innovationsindex gehört Deutschland mit Blick auf die Schaffung und Umsetzung von Wissen zu den führenden vier Ländern (…). Die Aktivierung von Wissen durch Forschung, Ausbildung und Unternehmertum ist unsere einzige Chance. Europas Zukunft liegt in der Wissensökonomie.“
Diese Hinweise auf die Wissensökonomie können nicht oft genug wiederholt werden. In einer Wissensökonomie kommt den Lernprozessen im Bildungswesen, in den Unternehmen, aber auch im privaten Bereich eine bedeutende Rolle zu: Lernen ist der Prozess und Wissen das Ergebnis (nach Willke). Dabei sollte Lernen nicht mehr als Anhäufung von Faktenwissen interpretiert werden, sondern eher als Kompetenzentwicklung im Sinne einer verbesserten Sebstorganisationsdisposition. Meines Erachtens werden diese Zusammenhänge viel zu wenig beachtet und damit wertvolles Potenzial vergeudet.
