
Es ist immer wieder erstaunlich, dass Struktuten wie die Europäische Union, Bundes- oder Landesregieren usw. immer wieder über Geld, also Kapital, sprechen, wenn es um Innovationen geht. Es werden Statistiken aufgefahren, die zeigen sollen, dass z.B. Deutschland X Milliarden in Forschung und Entwicklung steckt, und auch mit vielen Programmen Innovationen fördert. Viele der von einzelnen Menschen erbrachten Innovationen tauchen in diesen Statistiken allerdings gar nicht auf. Siehe dazu bespielsweise Eine etwas andere Perspektive auf den Bundesbericht Forschung und Innovation 2020.
Einerseits sind Investitionen in Forschung und Entwicklung nicht zwangsläufig Innovationen, wenn z.B. Patente nicht in marktfähige Produkte und Dienstleistungen umgesetzt werden. Andererseits haben die vielen Förderprogramme einen Wust an Aktivitäten ausgelöst, die nur mehr Innovationspreise, aber keine wirklichen Innovationen gebracht haben. Wie ich darauf komme? Wir haben in der Europäischen Unionen kein Amazon, kein Apple, kein Microsoft, kein Meta, kein etc., obwohl es wohl bei den Menschen für die entsprechenden Dienstleistungen einen Bedarf gibt. Wir sind gerade bei Zukunfstechnologien in eine bequeme, allerdings auch verhängnisvolle Abhängigkeit geraten. Das hat sich alles in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Gut erkennen kann man die dahinterliegende Denkweise an dem Vergleich der Smart City mit einer AI City:
„The governance of the AI city is aimed at the difficulties and pain points in the current city. The key point of using AI to explore is the grafting point of AI technology and urban governance needs rather than the top-down promotion of AI concepts. This is fundamentally different from the rise and promotion of any “smart city” in the past, which is different from the construction of smart infrastructure and a large and comprehensive technology platform with high investment from the government, and the AI city is reflected in the “peripheral nerve” of urban governance“ (Wu 2025).
Der Blick muss wieder auf die Bedürfnisse der Menschen gerichtet werden, nicht nur auf „Kapital“ und „Märkte“. Diese haben die vielen Probleme der Menschen in ihrem täglichen Umfeld bisher jedenfalls nicht gelöst, trotz aller Versprechen im Marketing, beim Qualitätsmanagement, Innovationsmanagement etc. und aktuell bei den Agilen Arbeitsweisen. Siehe dazu auch Produkte und Dienstleistungen als Mehrwert für Kunden: Warum funktioniert das einfach nicht?
„There is still an invisible hand behind supply-side reform. Adam Smith argued that the invisible hand that drives markets is capital, while the invisible hand of supply that drives innovation is demand. Generally speaking, the “inconvenience” in the daily life of the people can be used as the traction of technological development. In the AI technology market, enterprises that see fundamental needs can have a large number of applications for their products“ (Wu 2025).



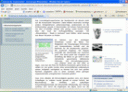
 EFFAS
EFFAS In meinem Blog habe ich immer wieder darüber geschrieben, dass man die
In meinem Blog habe ich immer wieder darüber geschrieben, dass man die 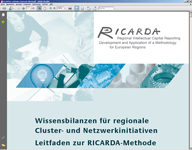
 Sammer stellt in dem Artikel
Sammer stellt in dem Artikel