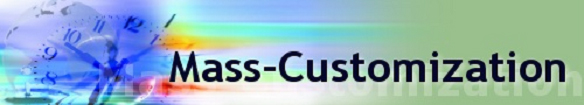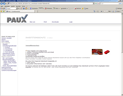Agilität war in den letzten mehr als 20 Jahren (Agiles Manifest 2001) ein Schwerpunkt für kollaboratives Arbeiten in komplexen Problemlösungssituationen – beispielsweise in innovativen Projekten. In der Zwischenzeit wird Agilität durch die Entwicklungen bei der Künstlichen Intelligenz etwas in der Wahrnehmung zurückgedrängt.
Dennoch möchte ich hier einen Ansatz zu Agilität vorstellen, den ich in einer Veröffentlichung der Dach30 gefunden habe. Dach30 bezeichnet eine Arbeitsgruppe aus 30 führenden Großunternehmen, für die Start-up-Standards wohl oft nicht ausreichen.
Dach30 (2019): Mindeststandards für Unternehmensagilität | PDF.
Darin wird gleich am Anfang der Zusammenhang zwischen Agilität und Shu Ha Ri hergestellt, das aus der asiatischen Kampfkunst hervorgegangen ist. Im Zusammenhang mit Agilität bedeutet Shu so viel wie kopieren, nachmachen, HA so etwas wie durchbrechen, abweichen, und RI so etwas wie neu verwenden. Die Arbeitsgruppe Dach 30 hat diese Zusammenhänge im folgenden Stufenmodell zusammengefasst:
| Shu | Ha | Ri |
| Kennt agile Werte und Prinzipien | Lebt agile Werte und Prinzipien | Verankert nachhaltig agile Werte und Prinzipien, gestaltet Governance aktiv |
| Begleitung durch einen Experten | Alleine | Anderen helfen |
| Doing Agile | Becoming Agile | Being Agile |
Aus diesen grundlegenden Überlegungen leitet die Arbeitsgruppe sehr viele „Learning Objects“ ab, was wiederum insgesamt ein umfangreiches Framework ergibt. Zunächst einmal erscheint alles sehr schlüssig und umsetzbar zu sein. Ergänzend möchte ich folgende Punkte anmerken:
(1) Shu Ha Ri wird hier mit Lernebenen, oder auch Kompetenzebenen assoziiert. Das erinnert stark an Dreyfus model of skill acquisition – Ebenen der Kompetenzentwicklung. Warum wird das Modell von Dreyfus nicht gleich verwendet? Warum der „Umweg“ über Shu Ha Ri? Weiterhin sollte man bedenken, dass Stufen-Modelle immer wieder kritisiert werden – auch im agilen Kontext.
(2) Wenn es um Stufen der Kompetenzentwicklung bei Agilität geht, so stellt sich für mich die Frage, ob Agilität in Organisationen nicht letztendlich bedeutet, Kompetenzentwicklung (Kompetenz als Selbstorganisationsdisposition) auf den Ebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk umzusetzen. Siehe dazu auch Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Ebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk.
(3) „Learning Objects“ sind hier als Inhalte gemeint, die gelernt werden sollten (Lernziele, Kompetenzentwicklung). Es sind allerdings Subjekte (nicht Objekte) die Lernen. Der Begriff „Learning Objects“ kann hier in die Irre führen. In meinen Veröffentlichungen habe ich in verschiedenen Paper immer wieder darauf hingewiesen. Das erste Mal ausführlich in Freund, R. (2003): Mass Customization in Education and Training, ELearnChina 2003, Edinburgh, Scotland. Download | Flyer.
Siehe dazu auch Agiles Lernen und selbstorganisierte Kompetenzentwicklung.