Das Projekt Innosite ist eine Open Innovation Platform for the Construction Industry aus Dänemark. Siehe dazu auch den Artikel Füller, J.: Die Demokratisierung der Architektur (Harvard Business Manager vom 31.08.2012).
Lukac, D.; Freund, R. (2012): Open Innovation, Social Embeddedness of Economic Action and its Cultural Determinants
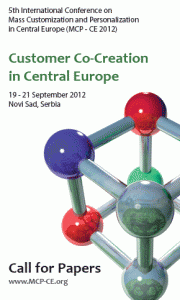 Gemeinsam mit Herrn Dr. Dusko Lukac von der Rheinischen Fachhochschule in Köln habe ich ein Paper zur MCP-CE 2012 geschrieben, das wir im September auf der Konferenz vorstellen werden:
Gemeinsam mit Herrn Dr. Dusko Lukac von der Rheinischen Fachhochschule in Köln habe ich ein Paper zur MCP-CE 2012 geschrieben, das wir im September auf der Konferenz vorstellen werden:
Lukac, D.; Freund, R. (2012): Open Innovation, Social Embeddedness of Economic Action and its Cultural Determinants
Abstract: The paper concerns the position of the economy within a socio-theoretical conception as a part of the new economic sociology, in the context of its influence of the economic action, especially in the macroeconomic view. Based on secondary research we review and challenge the primacy of economy in the contemporary society and we focus on the cultural determinantes for social embeddedness.
Siehe dazu auch Veröffentlichungen.
MCP-CE 2012: Customer Co-Creation in Central Europe
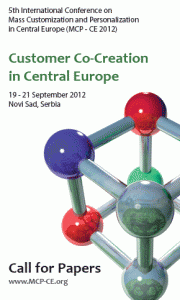 Die von mir initiierte Konferenz MCP-CE 2012 (5th International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe) findet vom 19-21.09.2012 in Novi Sad (Serbien) statt. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Customer Co-Creation in Central Europe. Zu den verschiedenen Perspektiven auf das Thema haben wir viele Paper erhalten die zeigen, wie facettenreich das Gebiet ist. Schauen Sie sich die Liste der Confirmed Participants und die Keynotes (u.a. Prof. Frank Piller, RWTH Aachen) an und kommen Sie zur Konferenz – ich würde mich freuen. Sollten Sie Fragen haben, so können Sie sich gerne an mich wenden:
Die von mir initiierte Konferenz MCP-CE 2012 (5th International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe) findet vom 19-21.09.2012 in Novi Sad (Serbien) statt. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Customer Co-Creation in Central Europe. Zu den verschiedenen Perspektiven auf das Thema haben wir viele Paper erhalten die zeigen, wie facettenreich das Gebiet ist. Schauen Sie sich die Liste der Confirmed Participants und die Keynotes (u.a. Prof. Frank Piller, RWTH Aachen) an und kommen Sie zur Konferenz – ich würde mich freuen. Sollten Sie Fragen haben, so können Sie sich gerne an mich wenden:
On behalf of the Organizational Board and Scientific Committee of the 5th International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe (MCP – CE 2012), we cordially invite you to participate and to share your research ideas, efforts and results with other scientists, entrepreneurs and corporate managers, dedicated to the idea of Mass Customization and Personalization.
Organized for the fifth time, the biannual MCP-CE conference would like to emphasize the role and importance of Customer Co-Creation that offers customers a chance to express their differences, and also an opportunity for innovations and new business models such as MC and Open Innovation platforms, for sharing designs and developments and benefits from the experiences of others.
Join us in Novi Sad 2012, share your ideas and become a part of our growing community.
Open Innovation oder doch besser Innovation Openess?
 In der aktuellen Debatte um die Öffnung des Innovationsprozesses wird häufig das Modell von Chesbrough (2003) genannt, das allerdings so seine Grenzen hat. In einer ausführlichen Literaturrecherche (West/Bogers 2011) haben die Autoren u.a die Linearität des Models von Chesbrough kritisiert und festgestellt, dass die kulrurellen Besonderheiten, bzw. die Reflexivität bei den Interaktionen (um nur einige Punkte zu nennen) noch zu wenig untersucht worden sind. Es verwundert daher nicht, dass sich von Hippel fundamental von Chesbrough unterscheidet, indem er Innovation Openess gemeinsam mit Baldwin wie folgt beschreibt: „An innovation is ‘open’ in our terminology when all information related to the innovation is a public good – non-rivalrous and non-excludable. This usage is closely related to the meaning of open in the terms ‘open source software’ (Raymond 1999) and ‘open science’ (Dasgupta and David 1994). It differs fundamentally from the recent use of the term to refer to organizational permeability – an organization’s ´openness´ to the aquisition of new ideas, patents, products, etc from outside its boundaries, often via licensing protected intellectual property (Chesbrough 2003)“ (Baldwin/von Hippel 2009:4-5). Insofern wundert es mich nicht, dass ich auf der MCPC 2011 in San Francisco nur Henry Chesbrough, aber nicht Eric von Hippel gesehen habe. Ich habe Eric von Hippel auf der MCPC 2007 am MIT in den USA in einem Vortrag erleben dürfen und muss sagen, dass mir seine Ansichten sehr gut gefallen. Meiner Meinung nach vertritt Eric von Hippel mit seiner Sicht stärker den Bottom-Up-Ansatz von Innovationen, die durch Interaktionen entstehen (Co-Creation) – nur eben nicht beschränkt auf Unternehmen..
In der aktuellen Debatte um die Öffnung des Innovationsprozesses wird häufig das Modell von Chesbrough (2003) genannt, das allerdings so seine Grenzen hat. In einer ausführlichen Literaturrecherche (West/Bogers 2011) haben die Autoren u.a die Linearität des Models von Chesbrough kritisiert und festgestellt, dass die kulrurellen Besonderheiten, bzw. die Reflexivität bei den Interaktionen (um nur einige Punkte zu nennen) noch zu wenig untersucht worden sind. Es verwundert daher nicht, dass sich von Hippel fundamental von Chesbrough unterscheidet, indem er Innovation Openess gemeinsam mit Baldwin wie folgt beschreibt: „An innovation is ‘open’ in our terminology when all information related to the innovation is a public good – non-rivalrous and non-excludable. This usage is closely related to the meaning of open in the terms ‘open source software’ (Raymond 1999) and ‘open science’ (Dasgupta and David 1994). It differs fundamentally from the recent use of the term to refer to organizational permeability – an organization’s ´openness´ to the aquisition of new ideas, patents, products, etc from outside its boundaries, often via licensing protected intellectual property (Chesbrough 2003)“ (Baldwin/von Hippel 2009:4-5). Insofern wundert es mich nicht, dass ich auf der MCPC 2011 in San Francisco nur Henry Chesbrough, aber nicht Eric von Hippel gesehen habe. Ich habe Eric von Hippel auf der MCPC 2007 am MIT in den USA in einem Vortrag erleben dürfen und muss sagen, dass mir seine Ansichten sehr gut gefallen. Meiner Meinung nach vertritt Eric von Hippel mit seiner Sicht stärker den Bottom-Up-Ansatz von Innovationen, die durch Interaktionen entstehen (Co-Creation) – nur eben nicht beschränkt auf Unternehmen..
PharmaInnovationsLotse: Open Innovation in der Pharmabranche
Mit dem PharmaInnovationsLotsen können interessierte Unternehmen aus dem Pharmabereich ihren (Open) Innovationsprozess systematisch bearbeiten: „Der PharmaInnovationsLotse ist ein interaktives Konzept, welches das Open Innovation Management in der Pharmaindustrie unterstützt.“ Eine tolle Idee, zumal das Tool kostenfrei genutzt werden kann.
European Commission (2012): Open Innovation 2012
 Die Europäische Kommission hat sich in dem Jahrbuch European Commission (2012): Open Innovation 2012 (PDF, 4MB) nur mit Open Innovation befasst – und das mit gutem Grund, denn “ (…) one can clearly see that open innovation is knowledge society’s approach to well-being and sustainable development, both societally and economically. Open innovation can be very relevant when seeking and verifying the applicability of disruptive innovation outcomes in the society. These insights from a variety of views to service innovation are hopefully very stimulating to the reader who wishes to enter the new mainstream“ (S. 8).
Die Europäische Kommission hat sich in dem Jahrbuch European Commission (2012): Open Innovation 2012 (PDF, 4MB) nur mit Open Innovation befasst – und das mit gutem Grund, denn “ (…) one can clearly see that open innovation is knowledge society’s approach to well-being and sustainable development, both societally and economically. Open innovation can be very relevant when seeking and verifying the applicability of disruptive innovation outcomes in the society. These insights from a variety of views to service innovation are hopefully very stimulating to the reader who wishes to enter the new mainstream“ (S. 8).
Was ist bei Crowdsourcing-Projekten zu beachten?
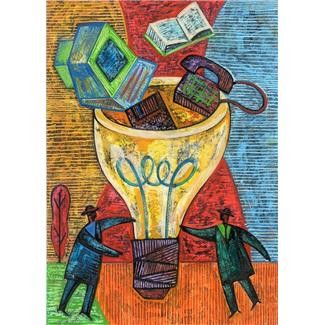 In dem Artikel Füller, J. (2012): Die Gefahren des Crowdsourcing (Harvard Business Manager, 27.06.2012) beschreibt der erfahrene Autor einige Crowdsourcing-Projekte und stellt dar, welche Grundsätze Manager beachten sollten: Transparente Kommunikation, schnelle Interaktion, authentisches Verhalten, echte Wertschätzung, ausreichende Unterstützung. Ich frage mich allerdings, warum man diesen Artikel gleich mit dem Wort „Gefahren“ garniert… Scheinbar muss in allen Schlagzeilen mindestens 1x das Wort „Risiko“, „Gefahr“ oder „Bedrohung“ vorkommen, um vor den strengen Blicken des Chefredakteurs zu bestehen. Jede Veränderung birgt Chancen und Risiken. Doch zurück zum Artikel: Die meisten dieser Punkte werden den klassischen Managern große Schwierigkeiten bereiten, weil sie auf solche Anforderungen gar nicht vorbereitet sind. Siehe dazu auch Freund et al. (2012): Customer Co-Creation and New Economic Sociology, Wittke, V.; Hanekop, H. (Eds.) (2011): New Forms of Collaborative Innovation and Production on the Internet, MCP-CE 2012: Co-Creation in Central Europe
In dem Artikel Füller, J. (2012): Die Gefahren des Crowdsourcing (Harvard Business Manager, 27.06.2012) beschreibt der erfahrene Autor einige Crowdsourcing-Projekte und stellt dar, welche Grundsätze Manager beachten sollten: Transparente Kommunikation, schnelle Interaktion, authentisches Verhalten, echte Wertschätzung, ausreichende Unterstützung. Ich frage mich allerdings, warum man diesen Artikel gleich mit dem Wort „Gefahren“ garniert… Scheinbar muss in allen Schlagzeilen mindestens 1x das Wort „Risiko“, „Gefahr“ oder „Bedrohung“ vorkommen, um vor den strengen Blicken des Chefredakteurs zu bestehen. Jede Veränderung birgt Chancen und Risiken. Doch zurück zum Artikel: Die meisten dieser Punkte werden den klassischen Managern große Schwierigkeiten bereiten, weil sie auf solche Anforderungen gar nicht vorbereitet sind. Siehe dazu auch Freund et al. (2012): Customer Co-Creation and New Economic Sociology, Wittke, V.; Hanekop, H. (Eds.) (2011): New Forms of Collaborative Innovation and Production on the Internet, MCP-CE 2012: Co-Creation in Central Europe
Betriebliche Innovationsstrategien ohne Mass Customization?
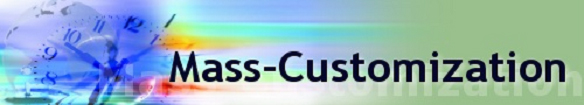 Das gerade erschienene Faktenblatt RKW (2012): Betriebliche Innovationsstrategien (PDF) zeigt verschiedene Strategien auf: Technolgieorientierte, Wettbewerbsorientierte, Marktorientierte, Zeitorientierte und Kooperationsorientierte Innovationsstrategie. Das ist zunächst gut und schön, doch hätte ich mir gewünscht, dass das RKW auch auf z.B. die hybride Wettbewerbsstrategie Mass Customization verweist. Immerhin gibt es vom RKW dazu auch ein Faktenblatt: Freund, R. (2009): Kundenindividuelle Massenproduktion (Mass Customization). Durch die Vernetzung der einzelnen Faktenblätter würde es bei den KMU zu einem Mehrwert kommen – von Open Innovation ganz zu schweigen… Siehe dazu auch Konferenzen und Innovationsmanager.
Das gerade erschienene Faktenblatt RKW (2012): Betriebliche Innovationsstrategien (PDF) zeigt verschiedene Strategien auf: Technolgieorientierte, Wettbewerbsorientierte, Marktorientierte, Zeitorientierte und Kooperationsorientierte Innovationsstrategie. Das ist zunächst gut und schön, doch hätte ich mir gewünscht, dass das RKW auch auf z.B. die hybride Wettbewerbsstrategie Mass Customization verweist. Immerhin gibt es vom RKW dazu auch ein Faktenblatt: Freund, R. (2009): Kundenindividuelle Massenproduktion (Mass Customization). Durch die Vernetzung der einzelnen Faktenblätter würde es bei den KMU zu einem Mehrwert kommen – von Open Innovation ganz zu schweigen… Siehe dazu auch Konferenzen und Innovationsmanager.
Digitale Gesellschaft: Machen Sie mit
3-D-Druck als reflexive Innovation?
 Der aktuelle Artikel Und jetzt kommt die 3-D-Druck-Revolution (SZ vom 31.05.2012) thematisiert die Urherberrechtdebatte aus einer anderen Perspektive: Die Perspektive der Fabbers. Einerseits können Unternehmen mit Rapid Prototyping oder Additive Manufacturing viele Vorteile generieren, doch das eigentliche Potenzial der Fabbers liegt „im log Tail“ der User/Nutzer, die sich bisher an Unternehmen wenden mussten, um ihr Produkt mehr schlecht als Recht zu erhalten. Jetzt machen es die Nutze/User selbst mit Hilfe der gleichen Technologie ….. und benötigen möglicherweise in Zukunft die Unternehmen (teilweise) nicht mehr. Diese Reflexivität von Innovationen ist vielen Unternehmen gar nicht bewusst. In verschiedenen Papern (Veröffentlichungen) habe ich diesen Zusammenhang des öfteren dargestellt und von Reflexive Open Innovation gesprochen, z.B. in Freund, R.; Chatzopoulos, C.; Lalic, D. (2011): Reflexive Open Innovation in Central Europe.
Der aktuelle Artikel Und jetzt kommt die 3-D-Druck-Revolution (SZ vom 31.05.2012) thematisiert die Urherberrechtdebatte aus einer anderen Perspektive: Die Perspektive der Fabbers. Einerseits können Unternehmen mit Rapid Prototyping oder Additive Manufacturing viele Vorteile generieren, doch das eigentliche Potenzial der Fabbers liegt „im log Tail“ der User/Nutzer, die sich bisher an Unternehmen wenden mussten, um ihr Produkt mehr schlecht als Recht zu erhalten. Jetzt machen es die Nutze/User selbst mit Hilfe der gleichen Technologie ….. und benötigen möglicherweise in Zukunft die Unternehmen (teilweise) nicht mehr. Diese Reflexivität von Innovationen ist vielen Unternehmen gar nicht bewusst. In verschiedenen Papern (Veröffentlichungen) habe ich diesen Zusammenhang des öfteren dargestellt und von Reflexive Open Innovation gesprochen, z.B. in Freund, R.; Chatzopoulos, C.; Lalic, D. (2011): Reflexive Open Innovation in Central Europe.
