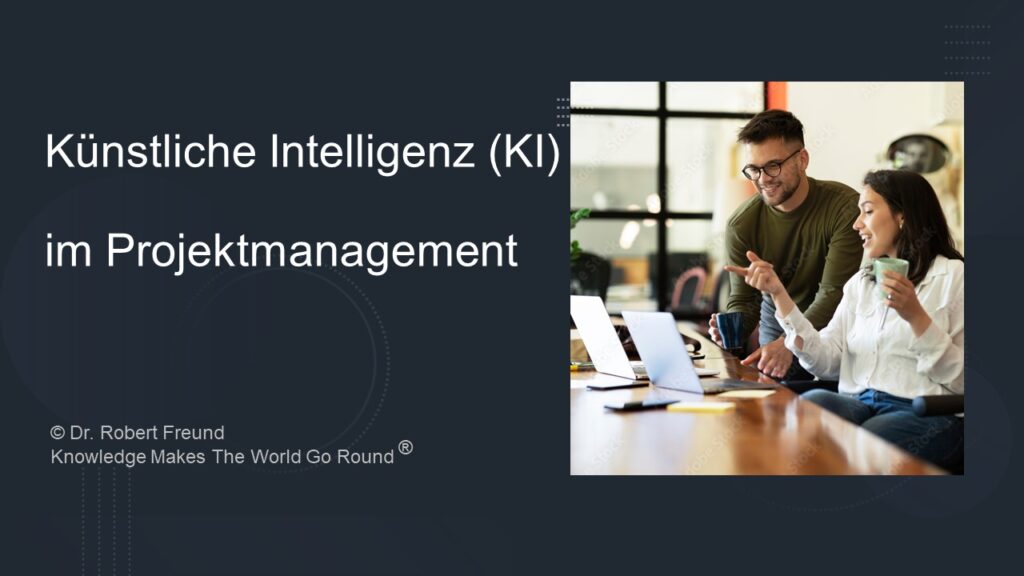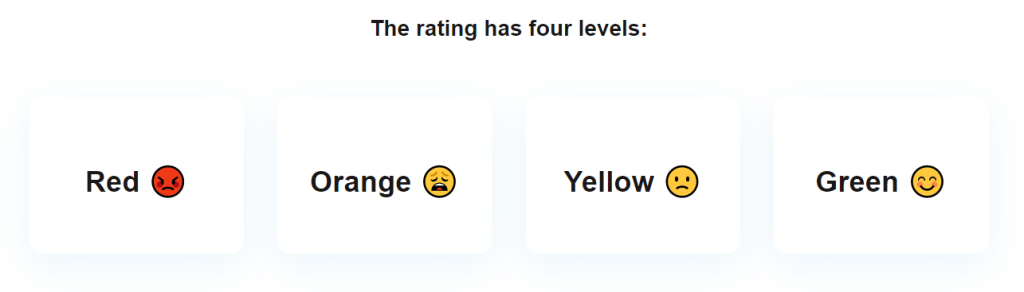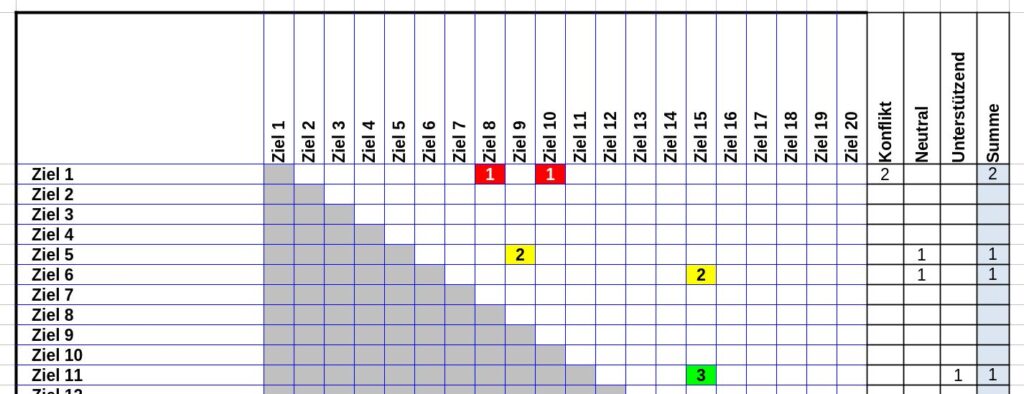Es ist allen klar, dass sich die Jobs in den nächsten Jahren weiter stark verändern werden. Möglicherweise geht es dabei um einzelne Tätigkeiten, Tätigkeitsportfolios oder komplette Jobs. Das World Economic Forum (WEF) veröffentlicht dazu immer wieder Reports. Einer davon wurde Anfang des Jahres veröffentlicht: WEF (2025): Future of Jobs Report 2025 (PDF).
Darin geht es um den Zeitraum 2025-2030, in dem aufgrund der laufenden technischen und energetischen Transition wohl 170 Millionen neue Jobs geschaffen, und 92 Millionen verschwinden werden:
„The world of work is changing fast. While 92 million jobs may disappear over the next 5 years, nearly 170 million new ones will emerge, driven by new technology and the energy transition. What are these new jobs and which sectors will see the greatest changes?“ (WEF 2025).
Ich möchte an dieser Stelle nicht auf alle Details der Veröffentlichung eingehen, doch halte ich folgenden Punkt durchaus für bemerkenswert:
„Additionally, Software and Applications Developers, General and Operations Managers, and Project Managers, are among the job categories driving the most net job growth“ (WEF 2025).
Die wachsende Nachfrage nach Projektmanagern wird hier allerdings nicht weiter erläutert. Ich gehe davon aus, dass Projektmanager in Zukunft die ganze Palette des Projektmanagement-Kontinuums mehr oder weniger intensiv (je nach Branche und Organisation) bewältigen müssen.
Dabei kann es im Laufe der Jahre natürlich auch zu Verschiebungen kommen. Beispielsweise von einer eher plangetriebenen Projektmanagement über das Agile Projektmanagement zu einem situationsspezifischen Hybriden Projektmanagement, das eher pragmatisch als dogmatisch ist. Alles natürlich auch immer zusammen mit den Entwicklungen bei der Künstlichen Intelligenz. Eine weiterhin anspruchsvolle Aufgabe.