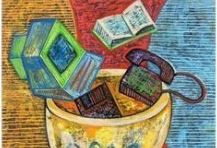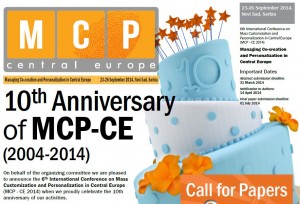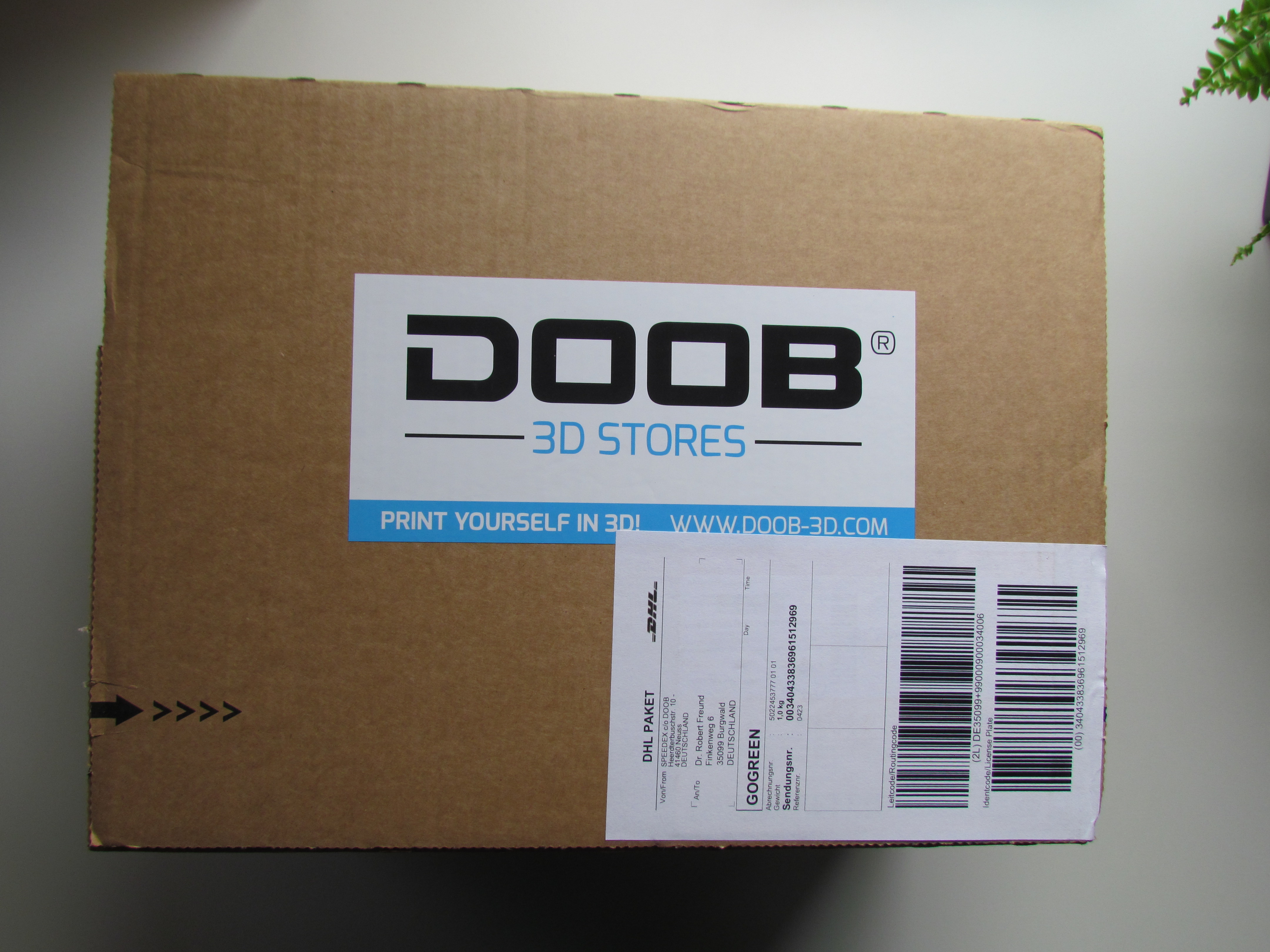In dem FAZ-Artikel Deutschlands Innovationsangst. Wir Neobiedermeier vom 06.09.2014 beschreibt der Autor schonungslos anhand der Innovationsstatistiken und Hightech-Strategien des Bundes, wie es um die deutsche Innovationskultur bestellt ist. In der Scheinwelt einer scheinbar innovativen Gesellschaft wird bisher nicht deutlich genug herausgestellt, dass Deutschland in vielen innovativen Bereichen auf dem absteigenden Ast ist. Nicht im europäischen, sondern im weltweiten Vergleich müssen wir uns messen lassen. Der FAZ-Artikel hat dafür einige schöne Formulierungen parat:
In dem FAZ-Artikel Deutschlands Innovationsangst. Wir Neobiedermeier vom 06.09.2014 beschreibt der Autor schonungslos anhand der Innovationsstatistiken und Hightech-Strategien des Bundes, wie es um die deutsche Innovationskultur bestellt ist. In der Scheinwelt einer scheinbar innovativen Gesellschaft wird bisher nicht deutlich genug herausgestellt, dass Deutschland in vielen innovativen Bereichen auf dem absteigenden Ast ist. Nicht im europäischen, sondern im weltweiten Vergleich müssen wir uns messen lassen. Der FAZ-Artikel hat dafür einige schöne Formulierungen parat:
Die Lust am Fortschritt, die Freude am Morgen, die Sehnsucht nach einer anderen, besseren Welt – davon ist in diesem Land nichts zu spüren. Deutschland ist ein Oberjammergau der Bedenkenhaftigkeit. Eine Abrechnung.