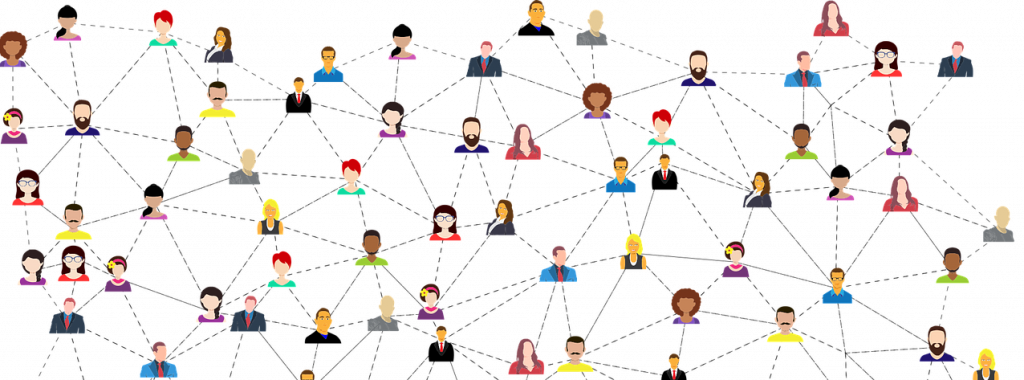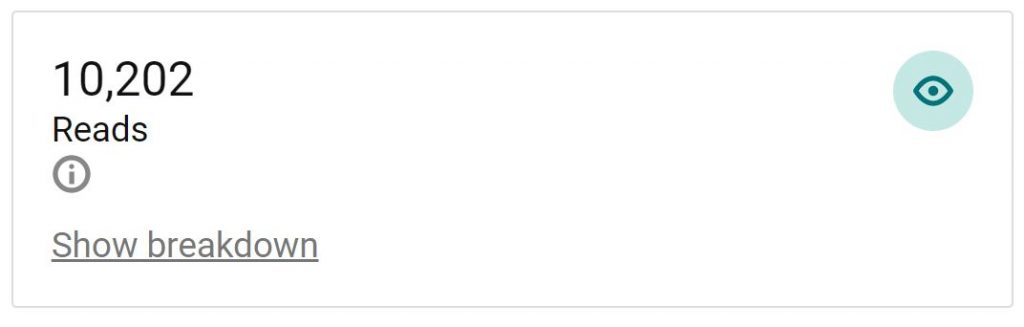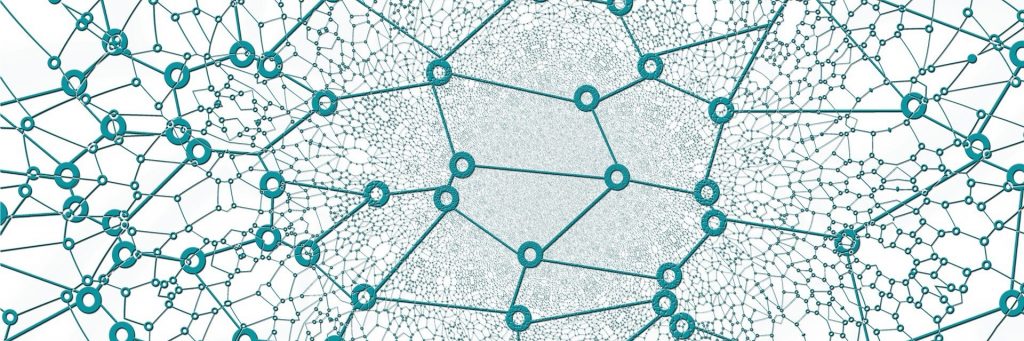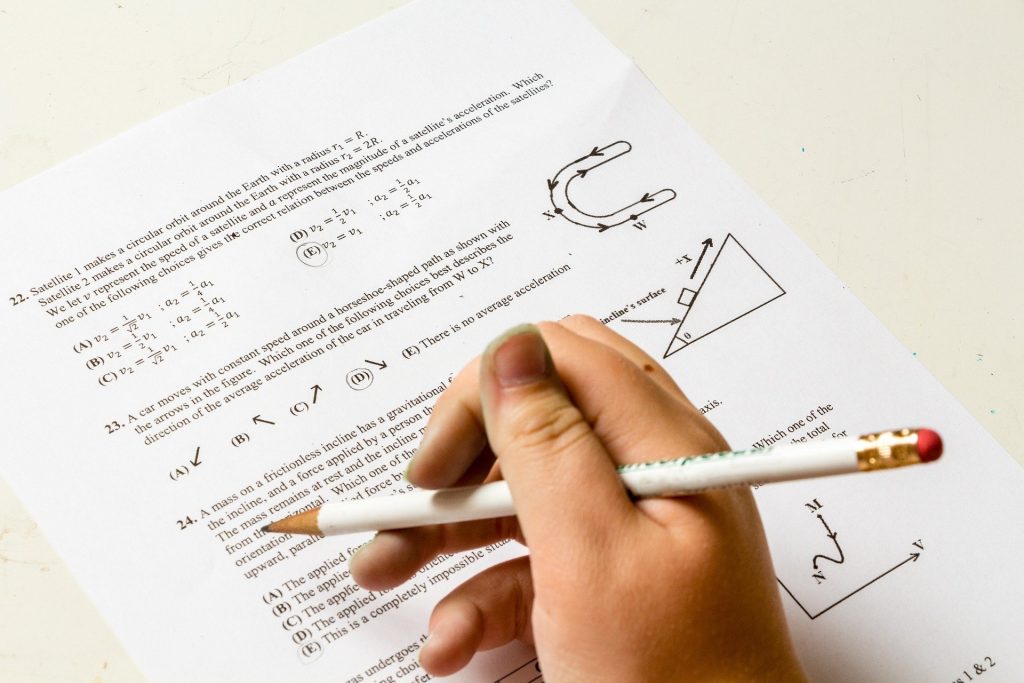Nach Martin (2001) ist es möglich, persönliche Intelligenzpräferenzen (Multiple Intelligenzen nach Howard Gardner) aufzuzeigen bzw. sogar eine persönliche Datenbank zu den Multiplen Intelligenzen zu erstellen. Darüber hinaus wird von Martin behauptet, dass man auch ein Jobprofil (einfach oder umfangreich erstellt) aus der Sicht der Multiplen Intelligenzen beschreiben kann. Ein Abgleich der Unterlagen könnte dann entweder für eine gezielte Weiterbildung, oder für die Anpassung des Jobprofils genutzt werden: „Ausbildung und Entwicklung sind bedeutende Investitionen in die Rentabilität. Der Einsatz der Fragebögen nach dem Modell der vielfachen Intelligenzen führt nicht nur zu spezifischeren Informationen über die Ausbildungsprioritäten, wie die Belegschaft sie sieht, sondern gibt auch ein wertvolles Feedback, wie die Vermittlung dieser Ausbildungs- und Entwicklungsprogramme verbessert werden kann“ (Martin 2001,:284).
Wie so etwas aussehen kann, hat Martin (2002) selbst vorgestellt, indem Sie das Berufsbild von Anwälten beschreibt, und daraus Erkenntnisse für die Ausbildung ableitet. Darüber hinaus zeigt Morris (2004) den Zusammenhang zwischen verschiedener Berufsgruppen mit den Multiplen Intelligenzen auf. Offen bleibt aber bei beiden, wie die Ergebnisse dann konkret in ein Konzept der Weiterbildung (Erwachsenenbildung) integriert werden können.
Gardner selbst weist auf folgenden Zusammenhang hin: „Die Multiple Intelligenz Theorie ist kein Unterrichtskonzept. Wissenschaftliche Aussagen über den Denkprozess und die Unterrichtspraxis sind zwei grundverschiedene Dinge. Pädagogen sind am besten in der Lage zu beurteilen, ob und in welchem Grad sie ihren Unterricht an der Theorie orientieren wollen“ (Gardner 2002:111).