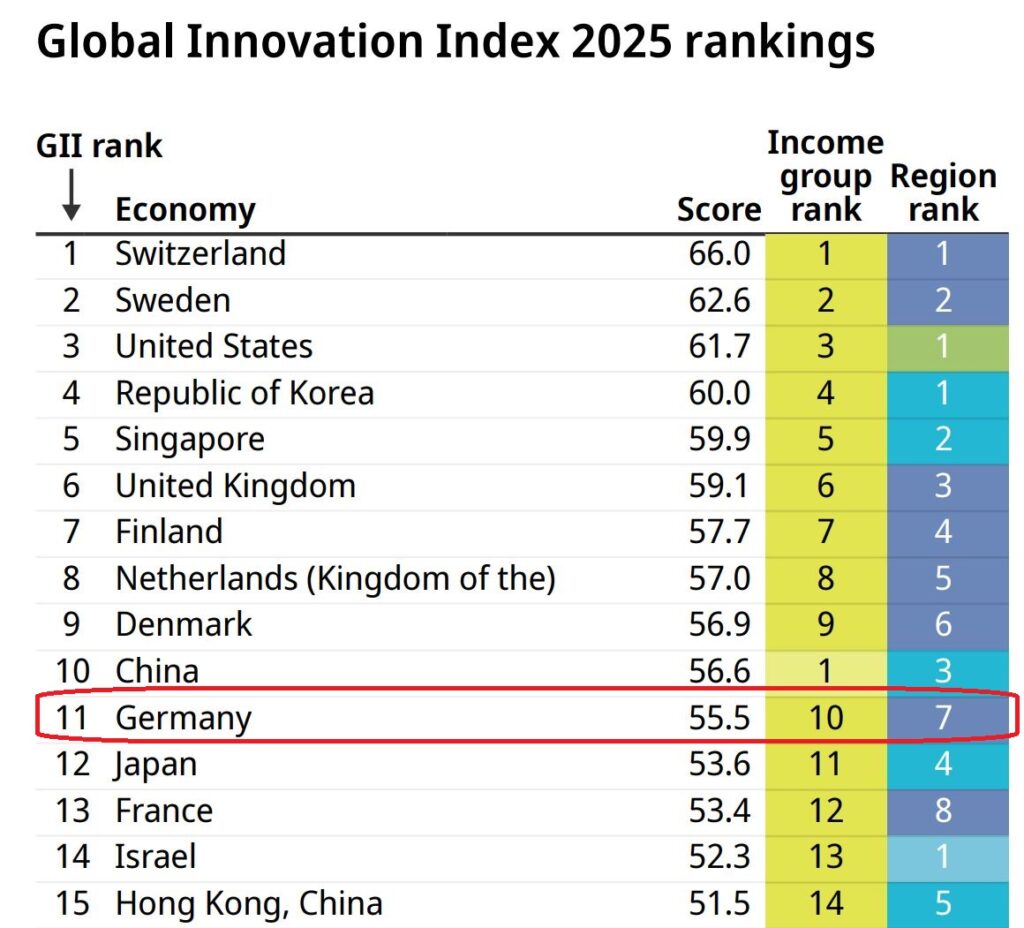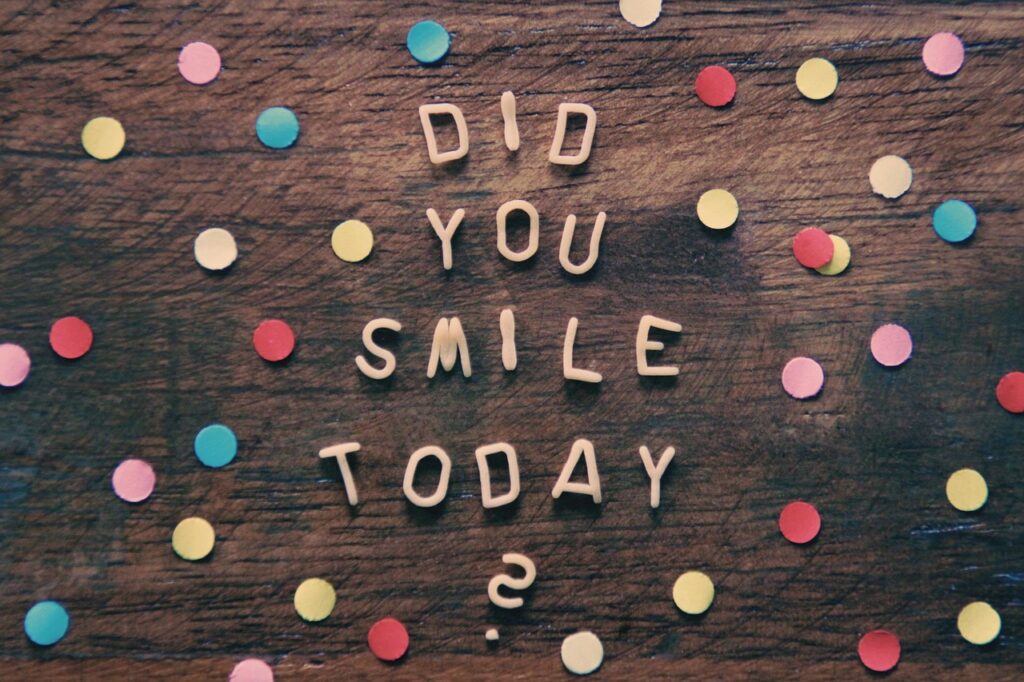
Das gesellschaftliche Zusammenleben wird durch Gesetze geregelt, die sich oftmals historisch entwickelt haben. Dabei spielen Kultur und die damit verbundenen „Werte“ eine große Rolle. Die Bedeutung des Begriffs soll nun geklärt, und zu dem Begriff „Wert“ abgegrenzt werden. Dazu habe ich folgende Texte in einer aktuellen Studie gefunden:
„Der Begriff »Werte« unterscheidet sich vom Begriff »Wert« dadurch, dass der erste Begriff die Gründe beschreibt, warum etwas für jemanden wichtig ist. Werte repräsentieren normative Grundlagen, die als Leitprinzipien für individuelles Verhalten und gesellschaftliche Strukturen dienen. Sie bilden die Basis für die Bewertung von Wert und beeinflussen die Art und Weise, wie Individuen und Gesellschaften Güter, Dienstleistungen oder Handlungen priorisieren“ (Hämmerle et al. 2025, Fraunhofer HNFIZ).
Die Autoren weisen in ihrer Studie zur Transformation zu einer Wertschöpfung der Zukunft darauf hin, dass der Begriff »Wert« durchaus unterschiedlich interpretiert werden kann. Beispielhaft wird auf von Froese (2024) hingewiesen, der meint, in unseren westlichen Gesellschaften ginge es dabei eher um ökonomische oder auch statusbezogene Bewertungen. Andererseits hat Mazzucato (2018) darauf verwiesen, „dass Wert stets politisch und gesellschaftlich geprägt ist und über rein ökonomische Kategorien hinausgeht“ (ebd.).
Es wird meines Erachtens immer deutlicher, dass wir uns gesellschaftlich und wirtschaftlich mehr und mehr in ein neues Werte- und Wertverständnis hineinbewegen (müssen), das über die rein wirtschaftlichen Dimensionen hinausgeht. Siehe dazu auch
Produkte und Dienstleistungen als Mehrwert für Kunden: Warum funktioniert das einfach nicht?
Open Source Community und die United Nations teilen die gleichen Werte.
Wertemanagement: 2 Veröffentlichungen und ein kritischer Beitrag.