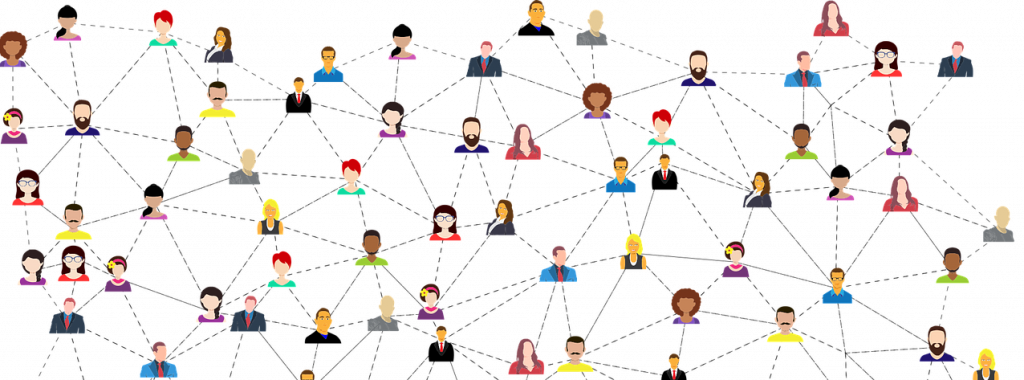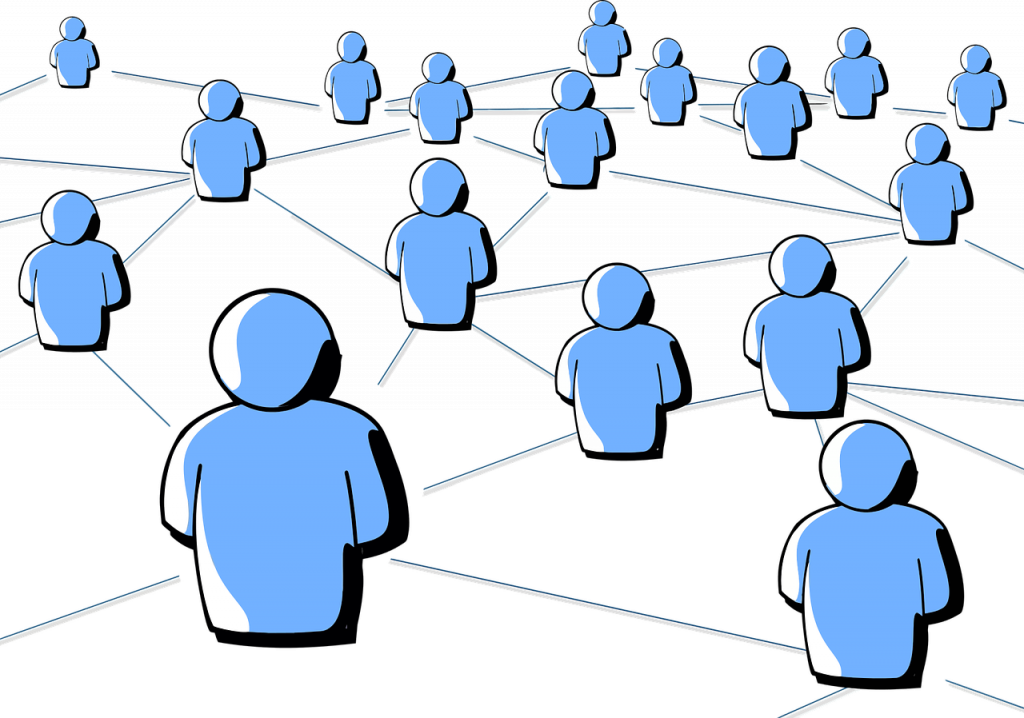
Um den Erfolg von Netzwerken sicher zu stellen, ist die Aufdeckung relevanter Einflussfaktoren bedeutsam. In der Literatur werden folgende Faktoren diskutiert (Denison/Grohmann 2009:431):
Vertrauen zwischen den Mitgliedern: Vertrauen wird sowohl im Bezug auf Netzwerke sowie auf Networking durchgängig als bedeutendes Merkmal bzw. als Basis der Beziehungen genannt (Baker, 1994; Elsholz & Meyer-Menk, 2002; Hanft, 1997; Uzzi, 1997). Vertrauen erleichtert es, Wissen zu teilen und kooperieren (Meyerson, Weick & Kramer, 1996).
Reziprozität (Gegenseitigkeit): Für Kooperationen in Netzwerken ist es ebenfalls von Bedeutung, dass der Austauschprozess zwischen den Partnern als angemessen und ausgewogen wahrgenommen wird (Elsholz & Meyer-Menk, 2002; Hanft, 1997).
Homogenität der Mitglieder innerhalb des Netzwerks: Die Homogenität bzw. Heterogenität der Netzwerke wird kontrovers diskutiert. Ergebnisse zeigen einerseits, dass bessere Lernerfolge in heterogen zusammengesetzten Netzwerken erzielt werden (Wilkesmann, 1999). Andererseits können in Netzwerken auf Grund der Austauschorientierung auch Vorteile homogen gestalteter Netzwerke erwartet werden (Ibarra, 1993).
Unterstützung der Mitglieder untereinander: Netzwerke können für die Teilnehmer eine Unterstützungsfunktion bieten, da sie Personen mit ähnlichen Arbeitsbedingungen und vergleichbaren Problemen zusammenbringen, die sich im Rahmen der Netzwerke auch über belastende Aspekte austauschen können (Jütte, 2002).
Commitment zum Netzwerk: Die Entwicklung einer gemeinsamen Identität gilt als Erfolgsfaktor für Netzwerke (Diettrich & Gillen, 2004). Durch ein hohes Commitment in einem Netzwerk, also die Identifikation mit der Gruppe, wird der Austausch zwischen den Netzwerkmitgliedern erleichtert (vgl. Nahapiet & Ghoshal, 1998).
Weitere Rahmenbedingungen: Als weitere Erfolgsfaktoren gelten die optimale Größe von Netzwerken und die Stabilität von Netzwerken. Je nach Zweck des Netzwerks wird bei eher ökonomisch orientierten Netzwerken eine optimale Größe von 10-50 Akteuren angegeben (Borkenhagen, Jäkel, Kummer, Megerle & Vollmer, 2004). Stabile Teilnehmergruppen, insbesondere ein stabiler Kern, gelten als bedeutsamer Aspekt für erfolgreiche Netzwerke (Diettrich & Gillen, 2004). Gerade der Personenwechsel kann lernen negativ beeinflussen (Wilkesmann, 1999).