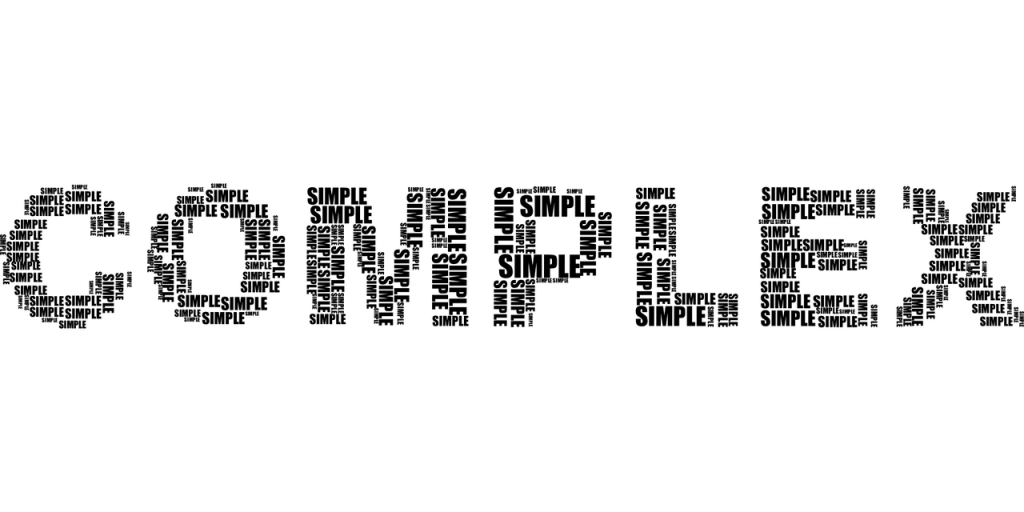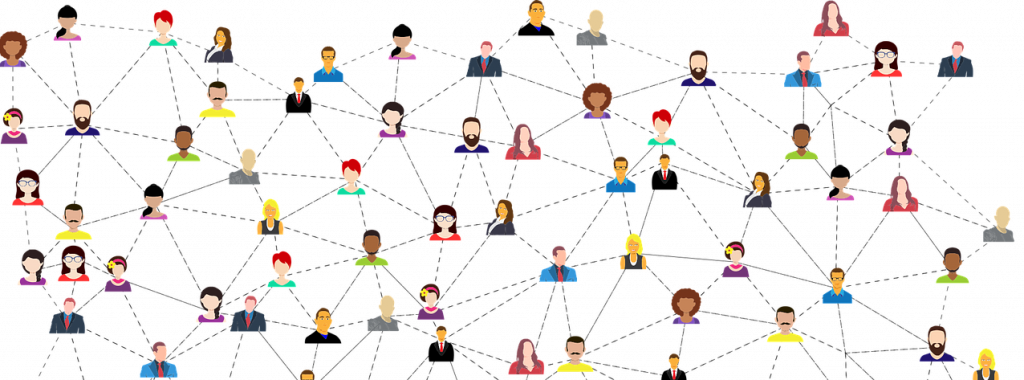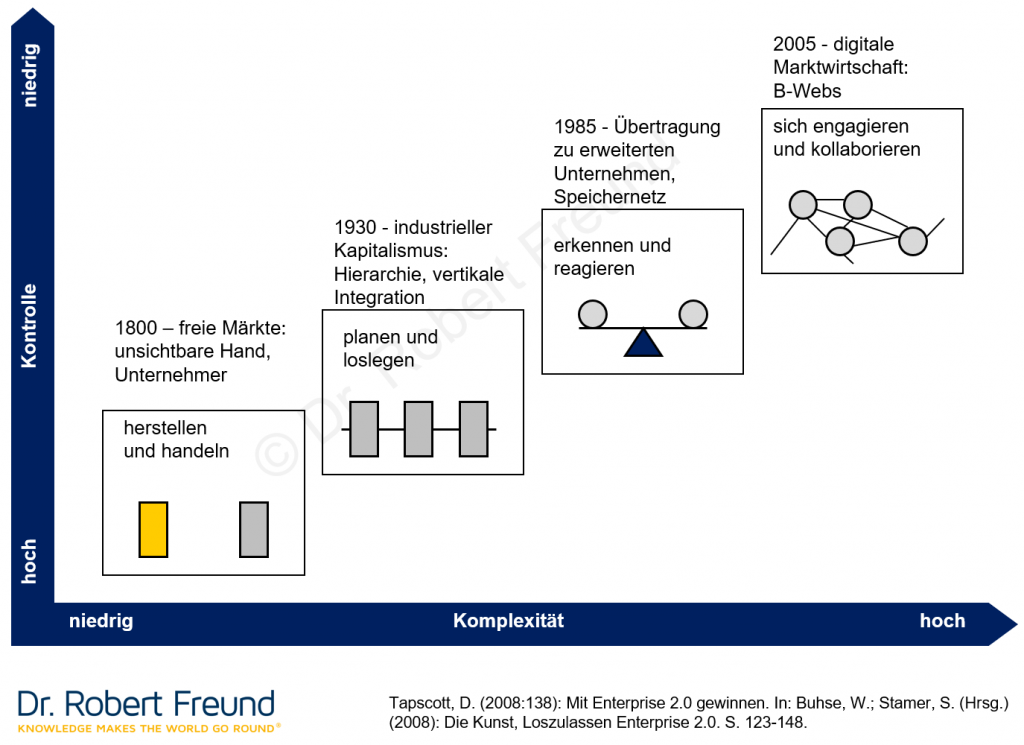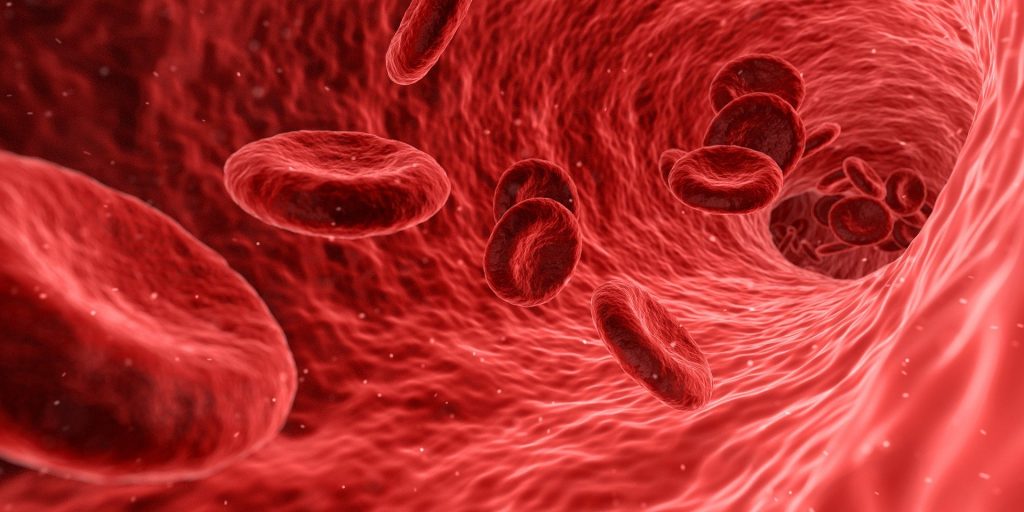In Zeiten von Corona ist Remote Work, also das Arbeiten nicht am Arbeitsplatz, sondern z.B. auch im Home Office, beliebt geworden. Immerhin braucht ein Arbeitnehmer nicht zum Arbeitsplatz hin und zurück zu pendeln, und spart somit Lebenszeit. Der Arbeitgeber spart dadurch Bürofläche, was scheinbar für alle eine Win-Win-Situation darstellt.
In der Zwischenzeit melden sich allerdings auch immer stärker kritische Stimmen: 5 Dinge, die an Remote Work nerven. Letztendlich weist auch das Whitepaper Die Arbeit der Zukunft ist Remote (PDF) auf den Seiten 5ff. darauf hin, dass es nicht nur die beiden Pole „Arbeiten am Arbeitsplatz“ oder „Remote arbeiten“, sondern viele verschiedene Mischformen gibt, die als Hybrides Arbeiten bezeichnet werden können.
In dem Artikel Hybrid Work Is the New Remote Work der Boston Consulting Group vom 22.09.2020 wird aufgezeigt, was das heisst: „Hybrid work models, done right, will allow organizations to better recruit talent, achieve innovation, and create value for all stakeholders. By acting boldly now, they can define a future of work that is more flexible, digital, and purposeful“.
Hybride Arbeitsmodelle ermöglichen es Personen, Teams, Organisationen und Netzwerke, Ungewissheit und Unsicherheit zu bewältigen. Analysieren Sie, welche Tätigkeiten gut remote, und welche eher kollaborativ im persönlichen Kontakt im Unternehmensumfeld bearbeitet werden können/sollten. Die Diskussion darüber wird wertvolle Ergebnisse bringen, und zu ihrem persönlichen Modell des hybriden Arbeitens führen. Dabei sollten immer wieder die neuen Arbeits-Anforderungen und die neuen technischen Möglichkeiten überprüft, und das hybride Arbeiten angepasst werden – möglichst in kurzen Zyklen und iterativ. Siehe dazu auch Von hybriden Produkten über hybride Wertschöpfung zur hybriden Wettbewerbsstrategie.