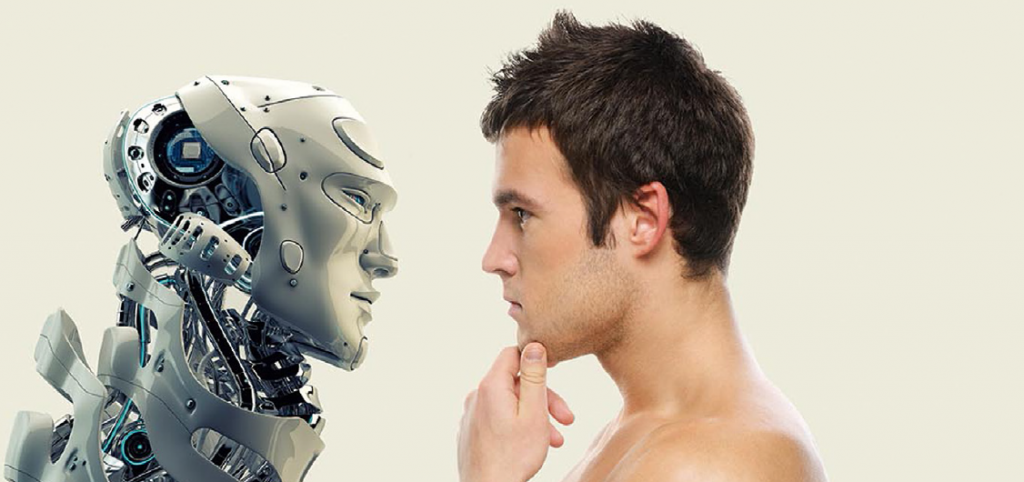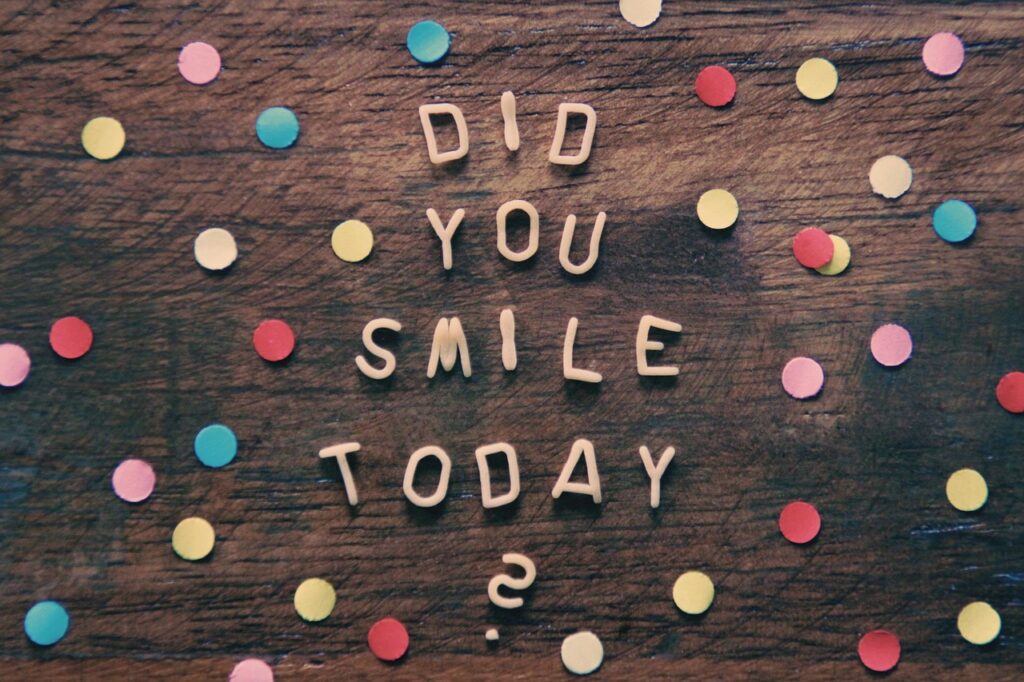Der Titel meines Beitrags bezieht sich auf die Philosophin Hannah Arendt, die vor Jahren die Frage stellte, was eine Arbeitsgesellschaft anstelle, der die Arbeit ausgehe (Arendt, H. (1981): Vita activa. Vom tätigen Leben, München),
Dabei ist zunächst einmal zu klären, was unter Arbeit zu verstehen ist, denn auch hier hat sich über die Zeit einiges verändert, was die Abkürzungen Arbeit 1.0, Arbeit 2.0, Arbeit 3.0 und Arbeit 4.0 beschreiben.
Ein wesentlicher Teil des heutigen Arbeitsverständnisses bezieht sich immer noch auf die Sicherung und Erweiterung des Lebensunterhaltes.
„Unter Arbeit verstehen wir die Vielfalt menschlicher Handlungen, deren Zweck die Sicherung und Erweiterung des Lebensunterhaltes der arbeitenden Individuen und ihrer Angehöriger ebenso beinhaltet wie die Reproduktion des gesellschaftlichen Zusammenhanges der Arbeitsteilung und hierüber der Gesellschaft selbst, Arbeit ist vergesellschaftetes Alltagsleben (von Ferber 1991)“ (Peter, G. (1992): Situation-Institution-System als Grundkategorien einer Arbeitsanalyse. In: ARBEIT 1/1992, Auszug aus S. 64-79. In: Meyn, C.; Peter, G. (Hrsg.) (2010)).
Dieses Verständnis von Arbeit kann dem Denken in einer Industriegesellschaft zugeordnet werden. Dazu gehören auch Entlohnungs-Systeme, Sozial-Systeme, Rechts-Systeme, Gesundheits-Systeme, Bildungs-Systeme usw.
Wenn sich also am Verständnis von Arbeit etwas ändert, hat das erhebliche Auswirkungen auf all die genannten, und nicht-genannten, gesellschaftlichen Systeme. Am Beispiel der Landwirtschaft kann das gut nachvollzogen werden: Nachdem hier automatisiert/industrialisiert wurde, gab es zwar weniger Arbeit in dem Bereich, doch mehr Arbeit in einem neuen Bereich, eben der Industrie.
Genau hier setzt ein neueres Verständnis Von Arbeit an, das sich aus dem Strukturbruch zwischen einfacher und reflexiver Modernisierung ableitet, und Arbeit ganzheitlicher betrachtet:
„Arbeit, und zwar das „Ganze der Arbeit“ (Biesecker 2000), sollte deshalb neu bestimmt werden, zunächst verstanden als „gesamtgesellschaftlicher Leistungszusammenhang“ (Kambartel 1993) der Reproduktion, woraus sich spezifische Rechte und Pflichten, Einkommen sowie Entwicklungschancen für die Mitglieder einer Gesellschaft ergeben. Von einem Ende der Arbeitsgesellschaft ist nämlich keine Rede mehr, wohl aber von einem Epochenbruch und der Notwendigkeit einer umfassenden Neugestaltung der gesellschaftlichen Arbeit“ (Peter/Meyn 2010).
Wenn Arbeit nun eher als „gesamtgesellschaftlicher Leistungszusammenhang“ gesehen werden sollte, bedeutet das natürlich, dass die auf dem früheren Begriff der Arbeit basierenden gesellschaftlichen Systeme (Gesundheits-System, Sozial-System Wirtschafts-System usw.) angepasst werden sollten.
Hinzu kommt, dass schon die nächste, von den Möglichkeiten der Künstlicher Intelligenz getriebene, Entwicklung ansteht. Dabei wird KI viele bisher bekannte Tätigkeitsportfolios verändern, und auch neue Tätigkeitsportfolios schaffen – und das relativ schnell. Siehe dazu KI und Arbeitsmarkt: Interessante Erkenntnisse aus einer aktuellen, belastbaren wissenschaftlichen Studie.
Aktuell hat man den Eindruck, dass alle gesellschaftlichen Systeme von den technologischen Entwicklungen getrieben werden, ganz im Sinne von Technology first. Es ist an der Zeit, Prioritäten zu verschieben – und zwar in Richtung Human first. Das ist möglich. Wie? Ein Beispiel:
„By comparison, Society 5.0 is “A human-centred society that balances economic advancement with the resolution of social problems by a system that highly integrates cyberspace and physical space” (Japan Cabinet Office, 2016, zitiert in Nielsen & Brix 2023).
Auch hier geht es um einen menschenzentrierten Ansatz, der allerdings nicht auf den Industriearbeiter begrenzt ist, sondern alle Bürger generell mitnehmen will. Dabei sollen die konkreten Probleme der Menschen (endlich) gelöst werden.
Da gibt es noch viel zu tun. So verstandene Arbeit geht nicht aus, und sollte in allen gesellschaftlichen Bereichen angemessen entlohnt werden.