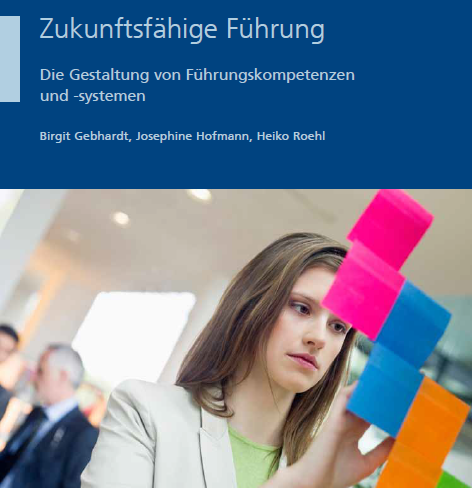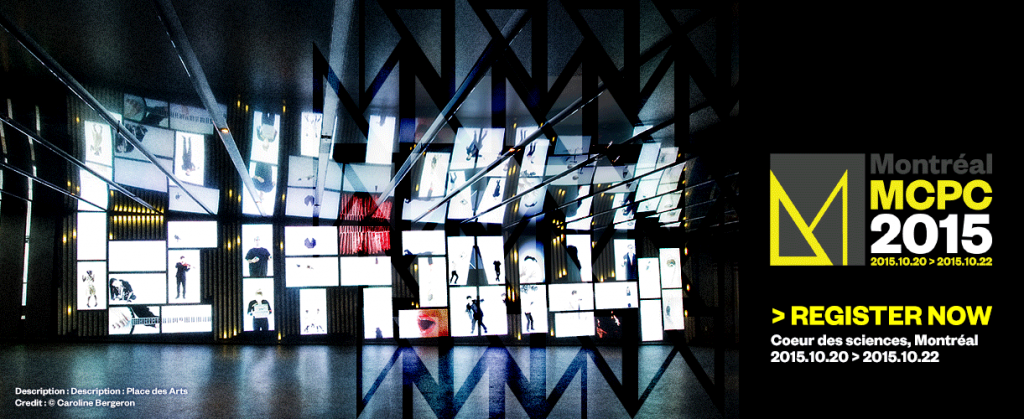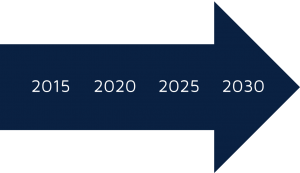 Ein weiterer Trend der gesellschaftlichen Veränderungen bis 2030 (PDF) wird Selbermachen 2.0 sein. „In Deutschland und weltweit beginnen immer mehr Personen wieder verstärkt damit, Produkte und Dienstleistungen alleine oder in Gruppen selbst herzustellen, statt sie zu kaufen. Die Entwicklung erstreckt sich auf vielerlei Güter – von Kleidung und Fahrrädern über Software und elektronische Steuergeräte bis hin zu Energie. Das Zusammenwirken verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungen mit neuen technischen Möglichkeiten birgt eine hohe Dynamik, die die Wertschöpfung bis 2030 stark verändern könnte“ (S. 100). Treiber dieser Entwicklung sind
Ein weiterer Trend der gesellschaftlichen Veränderungen bis 2030 (PDF) wird Selbermachen 2.0 sein. „In Deutschland und weltweit beginnen immer mehr Personen wieder verstärkt damit, Produkte und Dienstleistungen alleine oder in Gruppen selbst herzustellen, statt sie zu kaufen. Die Entwicklung erstreckt sich auf vielerlei Güter – von Kleidung und Fahrrädern über Software und elektronische Steuergeräte bis hin zu Energie. Das Zusammenwirken verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungen mit neuen technischen Möglichkeiten birgt eine hohe Dynamik, die die Wertschöpfung bis 2030 stark verändern könnte“ (S. 100). Treiber dieser Entwicklung sind
- Maker-Bewegung
- Co-creation, User Innovation, Open Innovation …
- Open Source, Open Design, Open Knowledge …
- FabLabs, 3D-Druck, Additive Manufacturing …
- …..,..
Diese Treiber führen zu ganz anderen Wertschöpfungsprozessen, die bestehende Prozesse verändern, oder gar ablösen: „Wertschöpfungsmuster mit hohem Anteil von ´Selbermachen´ erfordern andere Innovationsmodelle und Rollen für alle Akteure des Innovationssystems“ (S. 101). Darüber hinaus kommt es in Zukunft darauf an, solche Kompetenzen des Selbermachens (bzw. der Selbstorganisation) zu stärken – im Kindergarten, in der Schule, in den Unternehmen und im privaten Bereich. Der Kompetenzbegriff rückt somit automatisch in den Mittelpunkt, da heute Kompetenz als Selbstotganisationsdisposition verstanden wird. Wie Sie bei den Themen unseres Blogs sehen können, ist Kompetenzmanagement ein zentraler Aspekt (Siehe dazu auch Freund 2011. Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk). Weiterhin nehmen wir diese Themen auch in dem von uns entwickelten Blended Learning Lehrgang Innovationsmanager (IHK) mit auf. Informationen dazu finden Sie auf unserer Lernplattform.