 Vom 19.-20.05.2011 findet in Berlin der Wissensbilanz-Kongress „Standortvorteil Wissen“ statt (Programm). Am 2.Tag werde in der Themensession „Austausch zwischen Netzwerken und Moderatoren“ einen Vortrag zum Thema „Wissensbilanzen erfolgreich vermarkten“ halten. Veranstaltungsort: Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK), Pascalstraße 8-9, 10587 Berlin (Anfahrt). Es würde mich freuen, wenn Sie an dem Kongress teilnehmen und wir uns dort persönlich kennenlernen könnten.
Vom 19.-20.05.2011 findet in Berlin der Wissensbilanz-Kongress „Standortvorteil Wissen“ statt (Programm). Am 2.Tag werde in der Themensession „Austausch zwischen Netzwerken und Moderatoren“ einen Vortrag zum Thema „Wissensbilanzen erfolgreich vermarkten“ halten. Veranstaltungsort: Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK), Pascalstraße 8-9, 10587 Berlin (Anfahrt). Es würde mich freuen, wenn Sie an dem Kongress teilnehmen und wir uns dort persönlich kennenlernen könnten.
CYO 2011: Create Your Own – Conference, 30.-31.05.2011 in Berlin
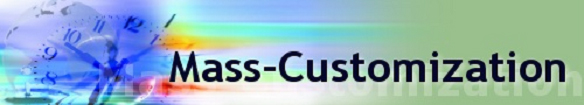 Eine ganz besondere Konferenz findet vom 30.-31. Mai in Berlin statt. Es ist die CYO 2011 (Create Your Own 2011): „Create Your Own 2011 (#cyo2011) is a unique opportunity to explore the reality and future behind mega trends that are shaping the European consumption landscape; individualization, co-creation, and personalization“. Die Konferenz bringt die Themen Mass Customization, Personalization und Open Innovation (?) nach Deutschland/Berlin. Wer bisher an den Weltkonferenzen nicht teilnehmen konnte, oder an der im November stattfindenen Weltkonferenz MCPC 2011 in San Francisco nicht teilnhehmen kann, sollte sich diesen Event nicht entgehen lassen. Ich frage mich allerdings, warum die Konferenz „Mass Customization Conference“ heißt und es um „Create Your Own“ geht. Im definierten Lösungsraum von Mass Customization habe ich nur begrenzte Möglichkeiten der Konfiguration. Es müsste dann eher „Configurate Your Own“ heißen… Wenn es in Richtung offener Lösungsraum geht (Open Innovation) so wäre es besser von „Let´s Create Our Own“ zu sprechen, da es im Netz häufig um eine kollaborative komplexe Problemlösung geht. Letztendlich verstehe ich nicht, warum ein von der EU gefördertes Projekt Geld für die Tickets verlangt. Wäre es nicht im Sinne einer geförderten Konferenz, den Zugang offen zu lassen?
Eine ganz besondere Konferenz findet vom 30.-31. Mai in Berlin statt. Es ist die CYO 2011 (Create Your Own 2011): „Create Your Own 2011 (#cyo2011) is a unique opportunity to explore the reality and future behind mega trends that are shaping the European consumption landscape; individualization, co-creation, and personalization“. Die Konferenz bringt die Themen Mass Customization, Personalization und Open Innovation (?) nach Deutschland/Berlin. Wer bisher an den Weltkonferenzen nicht teilnehmen konnte, oder an der im November stattfindenen Weltkonferenz MCPC 2011 in San Francisco nicht teilnhehmen kann, sollte sich diesen Event nicht entgehen lassen. Ich frage mich allerdings, warum die Konferenz „Mass Customization Conference“ heißt und es um „Create Your Own“ geht. Im definierten Lösungsraum von Mass Customization habe ich nur begrenzte Möglichkeiten der Konfiguration. Es müsste dann eher „Configurate Your Own“ heißen… Wenn es in Richtung offener Lösungsraum geht (Open Innovation) so wäre es besser von „Let´s Create Our Own“ zu sprechen, da es im Netz häufig um eine kollaborative komplexe Problemlösung geht. Letztendlich verstehe ich nicht, warum ein von der EU gefördertes Projekt Geld für die Tickets verlangt. Wäre es nicht im Sinne einer geförderten Konferenz, den Zugang offen zu lassen?
Projektmanager (IHK): Zusatzangebot der IHK Köln vom 15.06.-20.07.2011
 Da der von mir entwickelte Blended-Learning Lehrgang Projektmanager (IHK) mit Start im Mai schon ausgebucht ist, bietet die IHK Köln vom 15.06.-20.07.2011 zusatzlich einen weiteren Lehrgang an. Sollten Sie an dem Angebot interessiert sein, so können Sie mich oder Herrn Leuchter (IHK) Köln ansprechen: Telefon: 0221/1640-673, E-Mail: bernd.leuchter@koeln.ihk.de. Weitere Termine und Hinweise zu anderen Angeboten wie Innovationsmanager (IHK) oder Wissensmanager (IHK) finden Sie unter Termine.
Da der von mir entwickelte Blended-Learning Lehrgang Projektmanager (IHK) mit Start im Mai schon ausgebucht ist, bietet die IHK Köln vom 15.06.-20.07.2011 zusatzlich einen weiteren Lehrgang an. Sollten Sie an dem Angebot interessiert sein, so können Sie mich oder Herrn Leuchter (IHK) Köln ansprechen: Telefon: 0221/1640-673, E-Mail: bernd.leuchter@koeln.ihk.de. Weitere Termine und Hinweise zu anderen Angeboten wie Innovationsmanager (IHK) oder Wissensmanager (IHK) finden Sie unter Termine.
Pressemitteilung: Kongress „Standortvorteil Wissen“ vom 19.-20. Mai 2011 in Berlin
Kongress des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie am 19. und 20. Mai 2011 zur Zukunft des Wissensstandorts Deutschland / Anmeldung ab sofort möglich
Berlin, 10. März 2011 – Wissen ist Zukunft: Die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Deutschland hängt maßgeblich vom verfügbaren Wissen und der Innovationskraft der Unternehmen ab. Im Rahmen des Kongresses „Standortvorteil Wissen“ am 19. und 20. Mai 2011 in Berlin will das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK) die Bedeutung des Wissens für Unternehmen sowie den Wirtschaftsstandort Deutschland unterstreichen.
„Gerade für den Mittelstand, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, ist die wissensorientierte Unternehmensführung eine wichtige Grundlage für die Sicherung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit“, so Prof. Dr. Kai Mertins, Direktor Bereich Unternehmensmanagement am Fraunhofer IPK. „Deshalb hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie bereits im Jahr 2004 die Initiative ‚Fit für den Wissenswettbewerb’ gestartet, um Unternehmen auf dem Weg in die Wissensgesellschaft zu unterstützen.“ Auf dem Kongress „Standortvorteil Wissen“ werden die Verantwortlichen der Initiative Bilanz ziehen und aktuelle Themen der Wissensgesellschaft mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft diskutieren.
Deutschland ist auf dem Weg zur Wissensgesellschaft: Globale Wertschöpfungsketten, offene Innovationsprozesse und fast grenzenloser Zugang zu Information in einer digital vernetzen Welt sind die Herausforderungen der Zukunft. Für viele Unternehmen bedeutet das schon heute, dass der richtige Umgang mit Wissen oft ihr einziger Wettbewerbsvorteil ist. Innovation und Know-how hängen in vielen klein- und mittelständischen Unternehmen maßgeblich vom betrieblichen Wissen ab, das dadurch zu einem wichtigen Standortvorteil und kapitalen Unternehmenswert wird.
Unter www.akwissensbilanz.org/Veranstaltungen/kongress.htm können sich Interessenten ab sofort für den Kongress „Standortvorteil Wissen“ anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb wird um eine frühzeitige und verbindliche Anmeldung gebeten.
Innovationsmanager (IHK): Zusatzangebot im Mai bei der IHK Köln schon ausgebucht
 Im Januar 2011 haben wir den ersten Blended-Learning Lehrgang Innovationsmanager (IHK) mit 12 Teilnehmer (maximale Teilnehmerzahl) bei der IHK Köln mit Erfolg durchgeführt. Die Teilnehmerbeurteilungen waren durchweg positiv. Die permanente Nachfrage hat dazu geführt, dass die IHK Köln für Mai einen weiteren Lehrgang angeboten hat (Siehe Pressmitteilung). In der Zwischenzeit ist auch dieser Lehrgang (17.05.-21.06.2011) ausgebucht. Es freut mich natürlich sehr, dass unser neues Produkt so gut angenommen wird. Interessenten können sich bei Herrn Leuchter (IHK Köln) gerne auch schon über die neuen Termine im zweiten Halbjahr informieren: 0221/1640-673).
Im Januar 2011 haben wir den ersten Blended-Learning Lehrgang Innovationsmanager (IHK) mit 12 Teilnehmer (maximale Teilnehmerzahl) bei der IHK Köln mit Erfolg durchgeführt. Die Teilnehmerbeurteilungen waren durchweg positiv. Die permanente Nachfrage hat dazu geführt, dass die IHK Köln für Mai einen weiteren Lehrgang angeboten hat (Siehe Pressmitteilung). In der Zwischenzeit ist auch dieser Lehrgang (17.05.-21.06.2011) ausgebucht. Es freut mich natürlich sehr, dass unser neues Produkt so gut angenommen wird. Interessenten können sich bei Herrn Leuchter (IHK Köln) gerne auch schon über die neuen Termine im zweiten Halbjahr informieren: 0221/1640-673).
Kennen Sie das European Institute of Innovation (EIT)?
 Das European Institute of Innovation (EIT) kennt kaum jemand, obwohl es von 2009-2013 immerhin ein Budget von 308 Millionen Euro zur Verfügung hat. Doch in Zeiten von Plagiatsaffären, Landtagswahlen und Fußball gehen solche Kleinigkeiten schon einmal in der Berichterstattung unserer Medien unter – kann passieren. Ohne Innovationen wird die EU im globalen Wettbewerb allerdings zurückfallen und sein hohes gesellschaftliches Niveau nicht halten können.
Das European Institute of Innovation (EIT) kennt kaum jemand, obwohl es von 2009-2013 immerhin ein Budget von 308 Millionen Euro zur Verfügung hat. Doch in Zeiten von Plagiatsaffären, Landtagswahlen und Fußball gehen solche Kleinigkeiten schon einmal in der Berichterstattung unserer Medien unter – kann passieren. Ohne Innovationen wird die EU im globalen Wettbewerb allerdings zurückfallen und sein hohes gesellschaftliches Niveau nicht halten können.
„Innovation is the key to growth, competitiveness and thus social well-being in the 21st century. The capacity of a society to innovate will be crucial in an ever more knowledge-intensive economy. Innovation is also necessary in order to find new and lasting solutions to major global challenges, such as energy, climate change, or the future of information and communication. The European Institute of Innovation and Technology (EIT) is a new initiative which aims to become a flagship for excellence in European innovation in order to face these common challenges“.
Es sollte hier nicht nur um Produkt- oder Prozessinnovationen gehen, sondern auch um organisationale und gesellschaftliche (soziale) Innovationen. Es ist heute erforderlich, den Blick auf Innovationen zu weiten, den Begriff Innovation zu entgrenzen. Dazu gehören auch offene Innovationsprozesse (Open Innovation) auf allen Ebenen.
Robert Freund Newsletter 2011-02 an alle Abonnenten versandt
 Heute haben wir den Robert-Freund-Newsletter-2011-02 an alle Abonnenten versandt. Alle bisher erschienenen Newsletter finden Sie auf dieser Seite als PDF-Dateien. Sollten Sie an unserem monatlich erscheinenenden (kostenlosen) Newsletter interessiert sein, so senden Sie uns bitte eine E-Mail. Wir nehmen Sie gerne in unseren Verteiler auf. Denn Sie wissen doch:
Heute haben wir den Robert-Freund-Newsletter-2011-02 an alle Abonnenten versandt. Alle bisher erschienenen Newsletter finden Sie auf dieser Seite als PDF-Dateien. Sollten Sie an unserem monatlich erscheinenenden (kostenlosen) Newsletter interessiert sein, so senden Sie uns bitte eine E-Mail. Wir nehmen Sie gerne in unseren Verteiler auf. Denn Sie wissen doch:
K N O W L E D G EB M A K E SB T H E B W O R L D B G O B R O U N D ®
Intelligenz und Arbeitsleistung: Der IQ reicht heute alleine nicht mehr aus (Studie)
 Wieder zeigt eine Studie, dass ein hoher IQ alleine nicht ausreicht, um eine gute Arbeitsleistung in Unternehmen zu prognostizieren. In dem Artikel Ein hoher IQ reicht nicht aus (FTD vom 07.03.2011) (11.12.2013 Link nicht mehr aktiv) werden die Erkenntnisse einer Studie der Rotterdam School of Management (RSM) (11.12.2013 Link nicht mehr aktiv) zusammengefasst:
Wieder zeigt eine Studie, dass ein hoher IQ alleine nicht ausreicht, um eine gute Arbeitsleistung in Unternehmen zu prognostizieren. In dem Artikel Ein hoher IQ reicht nicht aus (FTD vom 07.03.2011) (11.12.2013 Link nicht mehr aktiv) werden die Erkenntnisse einer Studie der Rotterdam School of Management (RSM) (11.12.2013 Link nicht mehr aktiv) zusammengefasst:
„Die passenden Spezialisten zu engagieren, ist für Unternehmen wichtiger denn je. Doch wie wählt man sie aus? Menschen mit einem höheren Intelligenzquotienten sind nicht zwingend die mit den besseren Leistungen am Arbeitsplatz, sagt eine Studie“.
Der Artikel bezieht sich dabei auf folgendes Paper: Byington, E.; Felps, W. (2010): Why do IQ scores predict job performance?: An alternative, sociological explanation. In: Reserach in Organizational Behavior, Volume 30, 2010, Pages 175-202.
Es ist gut, wenn Tageszeitungen den Entscheidern im Finanzbereich aufzeigen, dass Personalauswahl nicht einfach so mit ein paar Zahlen erledigt ist, sondern sich viel komplexer gestaltet. Gerade in einer globalisierten Welt, mit Mitarbeitern aus allen möglichen kulturellen Regionen ist ein modernes Personalwesen entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg im Markt (Umgang mit Wissen, Innovationen möglichst schnell auf den Markt bringen usw.). Wer sich alleine auf den IQ-Test in Schule und Beruf verlässt, sollte sich diese Studie genauer ansehen. Es zeigt sich immer deutlicher, dass das Konzept des Intelligenz-Quotienten (IQ) erweitert werden sollte, da die erforderliche Passung zu den heutigen Arbeitsprozessen nicht mehr gegeben scheint.

Siehe dazu auch das Konzept der Multiplen Kompetenz oder Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk. In meiner Arbeit stelle ich ein entsprechendes Rahmenkonzept vor.
European Innovation Conference 2011: Open Innovation and New Business Creation
 Die European Innovation Conference 2011: Open Innovation and New Business Creation findet vom 29.-31.03.2011 in Dänemark statt. Zur Zielgruppe gehören Großunternehmen, die Open Innovation nutzen oder nutzen wollen. Es zeigt sich deutlich, wie wichtig Open Innovation für große Konzerne ist. Da viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) für Großkonzerne tätig sind, werden auch KMU in diesen Wertschöpfungsprozess mit einbezogen. KMU sollten sich daher rechtzeitig mit Open Innovation befassen. Keynote Speaker auf der Konferenz wird Henry Chesbrough sein. Siehe dazu auch der auch MCPC2011 (Weltkonferenz zu Mass Customization and Open Innovation).
Die European Innovation Conference 2011: Open Innovation and New Business Creation findet vom 29.-31.03.2011 in Dänemark statt. Zur Zielgruppe gehören Großunternehmen, die Open Innovation nutzen oder nutzen wollen. Es zeigt sich deutlich, wie wichtig Open Innovation für große Konzerne ist. Da viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) für Großkonzerne tätig sind, werden auch KMU in diesen Wertschöpfungsprozess mit einbezogen. KMU sollten sich daher rechtzeitig mit Open Innovation befassen. Keynote Speaker auf der Konferenz wird Henry Chesbrough sein. Siehe dazu auch der auch MCPC2011 (Weltkonferenz zu Mass Customization and Open Innovation).
VfL Bochum spielt gegen den Karlsruher SC nur 1:1
 Gestern haben wir uns das Heimspiel des VfL Bochum gegen den Karlsruher SC angesehen. Da der KSC gegen den Abstieg aus der zweiten Liga spielt und der VfL im Rennen um den Aufstieg in die erste Liga vor dem Spieltag auf dem dritten Tabellenplatz stand, waren die Voraussetzungen klar: Viele erwarteten einen deutlichen Sieg des VfL Bochum. Doch es kommt im Fußball nicht immer so, wie man es erwartet. Der VfL kontrollierte zwar das Spiel, doch setzte der KSC gefährliche Konter. Einen davon konnte Luthe im VfL Tor gerade noch abwehren, sonnst wäre der KSC schon in der ersten Halbzeit in Führung gegangen. Der VfL traf zwar 2x Pfosten und 1x Latte, doch so richtig zwingend waren die Aktionen des VfL nicht. Es fehlte einfach die Dynamik und Schnelligkeit im Spiel, um die gut gestaffelte Abwehr des KSC zu überwinden. Einer der diese Eigenschaften besitzt – Tese – konnte Friedhelm Funkel erst kurz vor Schluss des Spiels bringen, da der Angreifer des VfL immer wieder verletzt war. Tese schoss einen Freistoß zum 1:1 in die Maschen und hätte fast noch ein weiteres Tor erzielt. Mit Tese im Sturm hat die Offensive des VfL einfach mehr Power und Klasse. Möglicherweise kann Tese den VfL noch in die erste Bundesliga schiessen. Die nächsten Spiele werden es zeigen… Nach der verkorksten letzten Erstligasaison und dem äußerst schlechten Start in die jetzige Zweitligasaison ist es schon eine große Leistung des Teams, immer noch um den Aufstieg in die 1. Bundesliga mitspielen zu können.
Gestern haben wir uns das Heimspiel des VfL Bochum gegen den Karlsruher SC angesehen. Da der KSC gegen den Abstieg aus der zweiten Liga spielt und der VfL im Rennen um den Aufstieg in die erste Liga vor dem Spieltag auf dem dritten Tabellenplatz stand, waren die Voraussetzungen klar: Viele erwarteten einen deutlichen Sieg des VfL Bochum. Doch es kommt im Fußball nicht immer so, wie man es erwartet. Der VfL kontrollierte zwar das Spiel, doch setzte der KSC gefährliche Konter. Einen davon konnte Luthe im VfL Tor gerade noch abwehren, sonnst wäre der KSC schon in der ersten Halbzeit in Führung gegangen. Der VfL traf zwar 2x Pfosten und 1x Latte, doch so richtig zwingend waren die Aktionen des VfL nicht. Es fehlte einfach die Dynamik und Schnelligkeit im Spiel, um die gut gestaffelte Abwehr des KSC zu überwinden. Einer der diese Eigenschaften besitzt – Tese – konnte Friedhelm Funkel erst kurz vor Schluss des Spiels bringen, da der Angreifer des VfL immer wieder verletzt war. Tese schoss einen Freistoß zum 1:1 in die Maschen und hätte fast noch ein weiteres Tor erzielt. Mit Tese im Sturm hat die Offensive des VfL einfach mehr Power und Klasse. Möglicherweise kann Tese den VfL noch in die erste Bundesliga schiessen. Die nächsten Spiele werden es zeigen… Nach der verkorksten letzten Erstligasaison und dem äußerst schlechten Start in die jetzige Zweitligasaison ist es schon eine große Leistung des Teams, immer noch um den Aufstieg in die 1. Bundesliga mitspielen zu können.
