 Lean Production ist seit dem Klassiker zu dem Thema Womack, J.; Jones, D.; Roos, D.: The Machine that changed the World: The Story of Lean Production. Harper Collins, New York 1990, ISBN 978-0-060-97417-6; deutsche Übersetzung: Womack, J.; Jones, D.; Roos, D.: Die zweite Revolution in der Autoindustrie. 4. Aufl., Campus, Frankfurt a. M. 1992 sehr bekannt, obwohl ich immer wieder feststellen muss, dass nur wenige das Original gelesen haben… In der Zwischenzeit gibt es natürlich auch Lean Management und Lean Thinking – Womack, J.; Jones, D.: Lean Thinking – Ballast abwerfen, Unternehmensgewinne steigern. Campus-Verlag, New York, 2004, S. 8. Auf der Website Lean Innovation der RWTH Aachen stellt Prof. G. Schuh allerdings fest, dass der Lean-Gedanke bisher noch nicht systematisch im Innovationsprozess umgesetzt wird. Es ist daher zwangläufig, dass er 12 Prinzipien festlegt, wie das nun gemacht werden kann. Aus dieser Perspektive ist ein komplettes Buch entstanden, das am 31.08.2013 veröffentlicht werden soll: Schuh, G. (2013): Lean Innovation. Ich werde mir das Buch ansehen – bin gespannt.
Lean Production ist seit dem Klassiker zu dem Thema Womack, J.; Jones, D.; Roos, D.: The Machine that changed the World: The Story of Lean Production. Harper Collins, New York 1990, ISBN 978-0-060-97417-6; deutsche Übersetzung: Womack, J.; Jones, D.; Roos, D.: Die zweite Revolution in der Autoindustrie. 4. Aufl., Campus, Frankfurt a. M. 1992 sehr bekannt, obwohl ich immer wieder feststellen muss, dass nur wenige das Original gelesen haben… In der Zwischenzeit gibt es natürlich auch Lean Management und Lean Thinking – Womack, J.; Jones, D.: Lean Thinking – Ballast abwerfen, Unternehmensgewinne steigern. Campus-Verlag, New York, 2004, S. 8. Auf der Website Lean Innovation der RWTH Aachen stellt Prof. G. Schuh allerdings fest, dass der Lean-Gedanke bisher noch nicht systematisch im Innovationsprozess umgesetzt wird. Es ist daher zwangläufig, dass er 12 Prinzipien festlegt, wie das nun gemacht werden kann. Aus dieser Perspektive ist ein komplettes Buch entstanden, das am 31.08.2013 veröffentlicht werden soll: Schuh, G. (2013): Lean Innovation. Ich werde mir das Buch ansehen – bin gespannt.
Open Innovation bedeutet auch Open Service Innovation
 Open Innovation wird immer noch zu sehr auf die Öffnung des Innovationsprozesses für physische Produkte angewendet. Das eigentliche Potential liegt allerdings in der Nutzung von Open Innovation für Dienstleistungen (Services). In dem EU-Jahrbuch zu Service Innovation geht Henry Chesbrough genau darauf ein: „Businesses today often labour under a product mindset as they innovate. What is needed instead is a new services mindset. This mindset will place the customer experience at the centre of a business’s purpose. It will unlock greater value for customers in their dealings with providers. It will differentiate providers and enhance margins. It will redesign business processes and business models. And it will lead to renewed growth for the business, and for an economy of such businesses.“ Quelle: Chesbrough, H. (2011): Open services innovation — a new mindset to find new sources of growth. In: EU (2011): Service Innovation Yearbook 200-2011, p. 13. Siehe dazu auch Corral, M. (2010: Put user in the center for services.
Open Innovation wird immer noch zu sehr auf die Öffnung des Innovationsprozesses für physische Produkte angewendet. Das eigentliche Potential liegt allerdings in der Nutzung von Open Innovation für Dienstleistungen (Services). In dem EU-Jahrbuch zu Service Innovation geht Henry Chesbrough genau darauf ein: „Businesses today often labour under a product mindset as they innovate. What is needed instead is a new services mindset. This mindset will place the customer experience at the centre of a business’s purpose. It will unlock greater value for customers in their dealings with providers. It will differentiate providers and enhance margins. It will redesign business processes and business models. And it will lead to renewed growth for the business, and for an economy of such businesses.“ Quelle: Chesbrough, H. (2011): Open services innovation — a new mindset to find new sources of growth. In: EU (2011): Service Innovation Yearbook 200-2011, p. 13. Siehe dazu auch Corral, M. (2010: Put user in the center for services.
Was motiviert uns eigentlich?
Können Sie sich eine Zukunft ohne Unternehmen vorstellen?
 Wie schon in einem meiner Beiträge erwähnt, hat der ORF einen Jahresschwerpunkt auf Open Innovation gelegt. Ich finde es schon wirklich erstaunlich, wie aktiv sich der ORF mit dem Themenbereich befasst. Im Rahmen dieser Reihe wurde am 22.07.2013 Nikolaus Franke, Leiter des Instituts für Entrepreneurschip und Innovation an der Universität Wien, interviewt. In dem Gespräch geht es um die Frage, ob es eine Zukunft ohne Unternehmen geben kann. Die Argumentationskette startet bei der Öffnung der Innovationsprozesse (Open Innovation und User Innovation), wobei der Fokus mehr auf User Innovation liegt. Gerade dieser Blickwinkel zeigt, wie sich Wertschöpfung in den letzten Jahren verändert hat und in Zukunft noch viel stärker verändern wird. In manchen Bereichen sind Unternehmen schon teilweise überflüssig geworden (Open Source usw.), in anderen stehen wir möglicherweise kurz davor: „Das Internet hat die Wirtschaft stark verändert. Innovative Produkte werden nicht zuletzt wegen der neuen Medien zunehmend in offenen Prozessen entwickelt. Eine Tendenz, die dazu führen könnte, dass Unternehmen in bestimmten Bereichen eines Tages komplett durch die Community abgelöst werden.“ Wie Forschungsergebnisse von Eric von Hippel in Großbrittannien, Japan, USA gezeigt haben, werden Innovationen immer mehr von Usern generiert, wobei den Lead Usern eine besondere Rolle zukommt. Ich darf darauf hinweisen, dass ich Eric von Hippel auf der MCPC 2007 am MIT in den USA selbst erleben durfte. Seit dieser Zeit fasziniert mich dieser Ansatz immer mehr (Siehe dazu auch meine verschiedenen Veröffentlichungen). Dennoch gibt es auch für Unternehmen Möglichkeiten, von dem Trend zu profitieren. Wie? – Sprechen Sie mich an und vereinbaren Sie mit mir ein unverbindliches Gespräch. Siehe dazu auch Wie kann eine Organisation auf User Innovation ausgerichtet werden?
Wie schon in einem meiner Beiträge erwähnt, hat der ORF einen Jahresschwerpunkt auf Open Innovation gelegt. Ich finde es schon wirklich erstaunlich, wie aktiv sich der ORF mit dem Themenbereich befasst. Im Rahmen dieser Reihe wurde am 22.07.2013 Nikolaus Franke, Leiter des Instituts für Entrepreneurschip und Innovation an der Universität Wien, interviewt. In dem Gespräch geht es um die Frage, ob es eine Zukunft ohne Unternehmen geben kann. Die Argumentationskette startet bei der Öffnung der Innovationsprozesse (Open Innovation und User Innovation), wobei der Fokus mehr auf User Innovation liegt. Gerade dieser Blickwinkel zeigt, wie sich Wertschöpfung in den letzten Jahren verändert hat und in Zukunft noch viel stärker verändern wird. In manchen Bereichen sind Unternehmen schon teilweise überflüssig geworden (Open Source usw.), in anderen stehen wir möglicherweise kurz davor: „Das Internet hat die Wirtschaft stark verändert. Innovative Produkte werden nicht zuletzt wegen der neuen Medien zunehmend in offenen Prozessen entwickelt. Eine Tendenz, die dazu führen könnte, dass Unternehmen in bestimmten Bereichen eines Tages komplett durch die Community abgelöst werden.“ Wie Forschungsergebnisse von Eric von Hippel in Großbrittannien, Japan, USA gezeigt haben, werden Innovationen immer mehr von Usern generiert, wobei den Lead Usern eine besondere Rolle zukommt. Ich darf darauf hinweisen, dass ich Eric von Hippel auf der MCPC 2007 am MIT in den USA selbst erleben durfte. Seit dieser Zeit fasziniert mich dieser Ansatz immer mehr (Siehe dazu auch meine verschiedenen Veröffentlichungen). Dennoch gibt es auch für Unternehmen Möglichkeiten, von dem Trend zu profitieren. Wie? – Sprechen Sie mich an und vereinbaren Sie mit mir ein unverbindliches Gespräch. Siehe dazu auch Wie kann eine Organisation auf User Innovation ausgerichtet werden?
Gibt es eine „dark side of co-creation“?
RKW Kompetenzzentrum mit neuem Innovationsportal
 Das RKW Kompetenzzentrum engagiert sich stark für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Ein wichtiges Themenfeld ist dabei das Innovationsmanagement. Die verschiedenen Gebiete wie ein Inno-Check, Praxisbeispiele, Publikationen und eine Mediathek wurden nun gebündelt auf dem neuen Innovationsportal zusammengestellt: „Das RKW Innovationsportal ist Ihre Anlaufstelle zu unseren Projekten und Informationen rund um das Thema Innovation. Hier bekommen Sie eine Übersicht zu Fragen der Produktivität, des Innovationsmanagements und des ressourceneffizienten Wirtschaftens. Zusätzlich verrät Ihnen unser Inno-Check, wo sich in Ihrem Unternehmen noch Potentiale verbergen. Nutzen Sie die Ergebnisse.“ Einige der hier genannten Themen nehme ich auch in dem von uns entwickelten Blended Learning Lehrgang Innovationsmanager (IHK) auf. Sollten Sie dazu weitere Informationen benötigen, so sprechen Sie mich bitte an.
Das RKW Kompetenzzentrum engagiert sich stark für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Ein wichtiges Themenfeld ist dabei das Innovationsmanagement. Die verschiedenen Gebiete wie ein Inno-Check, Praxisbeispiele, Publikationen und eine Mediathek wurden nun gebündelt auf dem neuen Innovationsportal zusammengestellt: „Das RKW Innovationsportal ist Ihre Anlaufstelle zu unseren Projekten und Informationen rund um das Thema Innovation. Hier bekommen Sie eine Übersicht zu Fragen der Produktivität, des Innovationsmanagements und des ressourceneffizienten Wirtschaftens. Zusätzlich verrät Ihnen unser Inno-Check, wo sich in Ihrem Unternehmen noch Potentiale verbergen. Nutzen Sie die Ergebnisse.“ Einige der hier genannten Themen nehme ich auch in dem von uns entwickelten Blended Learning Lehrgang Innovationsmanager (IHK) auf. Sollten Sie dazu weitere Informationen benötigen, so sprechen Sie mich bitte an.
Chesbrough, H.; Brunswicker, S. (2013): Managing Open Innovation in large firms
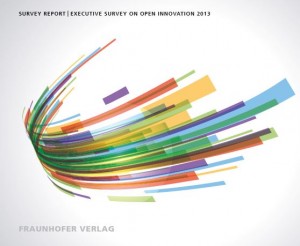 Open Innovation ist erst seit der Veröffentlichung des Buchs Chesbrough, H.W. (2003): Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology, Boston: Harvard Business School Press, S. XXIV in aller Munde. Es hat mich erstaunt, dass schon wenige Jahre danach, die ersten großen Unternehmen Open Innovation ganz bewusst in Ihre Unternehmensstrategie eingebaut haben. Da solche Entwicklungen bei großen Unternehmen ja bekanntlich nicht so schnell verlaufen, kann ich mir gut vorstellen, dass die Öffnung der Innovationsprozesse nicht erst nach dem Buch von Chesbrough initiiert wurde, sondern diese Öffnung ein Kontinuum zwischen Closed Innovation und Open innovation darstellt. Die jetzt vorliegende Studie Chesbrough, H.; Brunswicker, S. (2013): Managing Open Innovation in large firms haben die UC Berkeley und die Fraunhofer-Gesellschaft zusammen erarbeitet. Auf der Website des Fraunhofer-Instituts werden die Ergebnisse wie folgt zusammengefasst:
Open Innovation ist erst seit der Veröffentlichung des Buchs Chesbrough, H.W. (2003): Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology, Boston: Harvard Business School Press, S. XXIV in aller Munde. Es hat mich erstaunt, dass schon wenige Jahre danach, die ersten großen Unternehmen Open Innovation ganz bewusst in Ihre Unternehmensstrategie eingebaut haben. Da solche Entwicklungen bei großen Unternehmen ja bekanntlich nicht so schnell verlaufen, kann ich mir gut vorstellen, dass die Öffnung der Innovationsprozesse nicht erst nach dem Buch von Chesbrough initiiert wurde, sondern diese Öffnung ein Kontinuum zwischen Closed Innovation und Open innovation darstellt. Die jetzt vorliegende Studie Chesbrough, H.; Brunswicker, S. (2013): Managing Open Innovation in large firms haben die UC Berkeley und die Fraunhofer-Gesellschaft zusammen erarbeitet. Auf der Website des Fraunhofer-Instituts werden die Ergebnisse wie folgt zusammengefasst:
„Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, dass Open Innovation keine Modeerscheinung ist, sondern eine nachhaltige Entwicklung“, so Open Innovation-Vater Henry Chesbrough über die Publikation. Nach der Befragung sind die Unternehmen, die bereits Erfahrungen mit der Praxis haben, mit den Ergebnissen zufrieden – und zufriedener, je mehr Erfahrung sie haben. Der Spielraum ist aber noch längst nicht ausgeschöpft. »Unternehmen werden in den nächsten Jahren noch viel Erfahrung sammeln, um von Open Innovation zu profitieren, und so wird sich das Phänomen stetig weiterentwickeln«, so Chesbrough. Die größte Herausforderung liegt dabei innerhalb der Unternehmen: Und zwar im organisatorischen Wandel weg vom geschlossen zum offenen Modell und im Aufbau neuer Strukturen, Prozesse und Verantwortlichkeiten.
An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich Henry Chesbrough persönlich auf der MCPC 2011 in San Francisco erleben durfte. Siehe dazu MCPC2011: Die Weltkonferenz in San Francisco. Sollten Sie an dem Thema interessiert sein, so sprechen Sie mich bitte an. Gerne können wir ein unverbindlichen Gespräch vereinbaren.
PUMA Factory: Immer mehr Mass Customization bei Puma
 Wie Thomas Davis – Global Head of E-Commerce for PUMA – in einem Interview zugibt, ist sein Unternehmen ein wenig hinter den aktuellen Entwicklungen zurück. Auf PUMA Factory kann man einen Sneaker anpassen (customization), doch sind die Freiheitsgrade sehr begrenzt. PUMA nimmt hier eine der vier Ebenen von Mass Customization sehr ernst: Fixed Solutionspace… Die Konfiguration selbst funktioniert richtig gut und schnell. Ich würde mir wünschen, dass ein Kunden mehr Optionen hat, seine Sneaker zu kreieren – doch dazu ist das Unternehmen wohl noch nicht bereit. Mal sehen, ob sich das in Zukunft noch ändern wird, denn bei dem Kunden ist der Trend ist eindeutig: „It´s the customer who determines what a business is“ (Drucker 1954).
Wie Thomas Davis – Global Head of E-Commerce for PUMA – in einem Interview zugibt, ist sein Unternehmen ein wenig hinter den aktuellen Entwicklungen zurück. Auf PUMA Factory kann man einen Sneaker anpassen (customization), doch sind die Freiheitsgrade sehr begrenzt. PUMA nimmt hier eine der vier Ebenen von Mass Customization sehr ernst: Fixed Solutionspace… Die Konfiguration selbst funktioniert richtig gut und schnell. Ich würde mir wünschen, dass ein Kunden mehr Optionen hat, seine Sneaker zu kreieren – doch dazu ist das Unternehmen wohl noch nicht bereit. Mal sehen, ob sich das in Zukunft noch ändern wird, denn bei dem Kunden ist der Trend ist eindeutig: „It´s the customer who determines what a business is“ (Drucker 1954).
Die nächste MCPC 2014 findet vom 04-07. Februar 2014 in Aalborg, Dänemark, statt
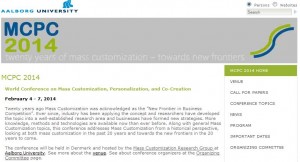 Nach der letzten MCPC 2011 (San Francisco, USA), der Weltkonferenz zu Mass Customization, Personalization and Co-creation, waren wir alle gespannt darauf zu erfahren, wo die nächste MCPC 2013 stattfinden würde. Nach langen Monaten des Wartens hieß es zunächst, dass die MCPC 2013 vom 13.-15.10.2013 am MIT in Boston staffinden würde. Kurze Zeit später wurden alle Community Member in einem Open Letter darüber informiert, dass die MCPC 2013 doch nicht am MIT stattfinden würde. Da ich bisher an ellen Weltkonferenzen teilgenommen hatte, war ich doch ein wenig überrascht von dieser Entwicklung, denn die Weltkonferenzen waren seit 2001 zu einem Eckpfeiler der weltweiten Community zu MCPC geworden. Nach einigen Wochen der „Schockstarre“ hat sich nun die Universität Aalburg in Dänemark dazu bereit erklärt, die nächste MCPC durchzuführen. Den Organisatoren ist zu verdanken, dass die Konferenzreihe weiter geht und es zu keinem „Bruch“ kommt. Durch die verschiedenen Zeitverzögerungen in den Ankündigungen ist es nun aber zu einer Verschiebung der Weltkonferenz von Oktober 2013 in den Februar 2014 gekommen: MCPC 2014. Das ist umso bedauerlicher, da die von mir initiierte Konferenz MCPC-CE auch in 2014 stattfindet – allerdings im September. Die Themen und die geographische Lage der beiden Konferenzen unterscheiden sich, doch hätte ich mir eine bessere Abstimmung untereinander gewünscht, zumal die Organisatoren der Weltkonferenz in Aalborg bisher auch immer an der MCPC-CE teilgenommen haben. Nichtsdestotrotz werden wir als Organisatoren der MCP-CE 2014 unsere Kollegen in Aalborg unterstützen und auch an der Weltkonferenz teilnehmen.
Nach der letzten MCPC 2011 (San Francisco, USA), der Weltkonferenz zu Mass Customization, Personalization and Co-creation, waren wir alle gespannt darauf zu erfahren, wo die nächste MCPC 2013 stattfinden würde. Nach langen Monaten des Wartens hieß es zunächst, dass die MCPC 2013 vom 13.-15.10.2013 am MIT in Boston staffinden würde. Kurze Zeit später wurden alle Community Member in einem Open Letter darüber informiert, dass die MCPC 2013 doch nicht am MIT stattfinden würde. Da ich bisher an ellen Weltkonferenzen teilgenommen hatte, war ich doch ein wenig überrascht von dieser Entwicklung, denn die Weltkonferenzen waren seit 2001 zu einem Eckpfeiler der weltweiten Community zu MCPC geworden. Nach einigen Wochen der „Schockstarre“ hat sich nun die Universität Aalburg in Dänemark dazu bereit erklärt, die nächste MCPC durchzuführen. Den Organisatoren ist zu verdanken, dass die Konferenzreihe weiter geht und es zu keinem „Bruch“ kommt. Durch die verschiedenen Zeitverzögerungen in den Ankündigungen ist es nun aber zu einer Verschiebung der Weltkonferenz von Oktober 2013 in den Februar 2014 gekommen: MCPC 2014. Das ist umso bedauerlicher, da die von mir initiierte Konferenz MCPC-CE auch in 2014 stattfindet – allerdings im September. Die Themen und die geographische Lage der beiden Konferenzen unterscheiden sich, doch hätte ich mir eine bessere Abstimmung untereinander gewünscht, zumal die Organisatoren der Weltkonferenz in Aalborg bisher auch immer an der MCPC-CE teilgenommen haben. Nichtsdestotrotz werden wir als Organisatoren der MCP-CE 2014 unsere Kollegen in Aalborg unterstützen und auch an der Weltkonferenz teilnehmen.
CCEMC Grand Challenge: Open Innovation-Projekt zur Nutzung von CO2 und Kohlenstoff
 Die Pressemitteilung CCEMC Grand Challenge: Open Innovation-Projekt zur Nutzung von CO2 und Kohlenstoff informiert über das Projekt: „Leuven (Belgien), 8. Juli 2013 – Der Countdown für das Ende der ersten Phase der CCEMC Grand Challenge läuft: noch bis zum 31. Juli haben Lösungsanbieter und Forschungseinrichtungen weltweit die Gelegenheit, ihre Vorschläge zum sinnvollen Gebrauch von CO2 und Kohlenstoff einzureichen. Das von der kanadischen Climate Change and Emissions Management Corporation (CCEMC) in Zusammenarbeit mit NineSigma initiierte Open Innovation-Projekt ist mit 35 Millionen CAD dotiert und auf fünf Jahre ausgelegt.“
Die Pressemitteilung CCEMC Grand Challenge: Open Innovation-Projekt zur Nutzung von CO2 und Kohlenstoff informiert über das Projekt: „Leuven (Belgien), 8. Juli 2013 – Der Countdown für das Ende der ersten Phase der CCEMC Grand Challenge läuft: noch bis zum 31. Juli haben Lösungsanbieter und Forschungseinrichtungen weltweit die Gelegenheit, ihre Vorschläge zum sinnvollen Gebrauch von CO2 und Kohlenstoff einzureichen. Das von der kanadischen Climate Change and Emissions Management Corporation (CCEMC) in Zusammenarbeit mit NineSigma initiierte Open Innovation-Projekt ist mit 35 Millionen CAD dotiert und auf fünf Jahre ausgelegt.“
